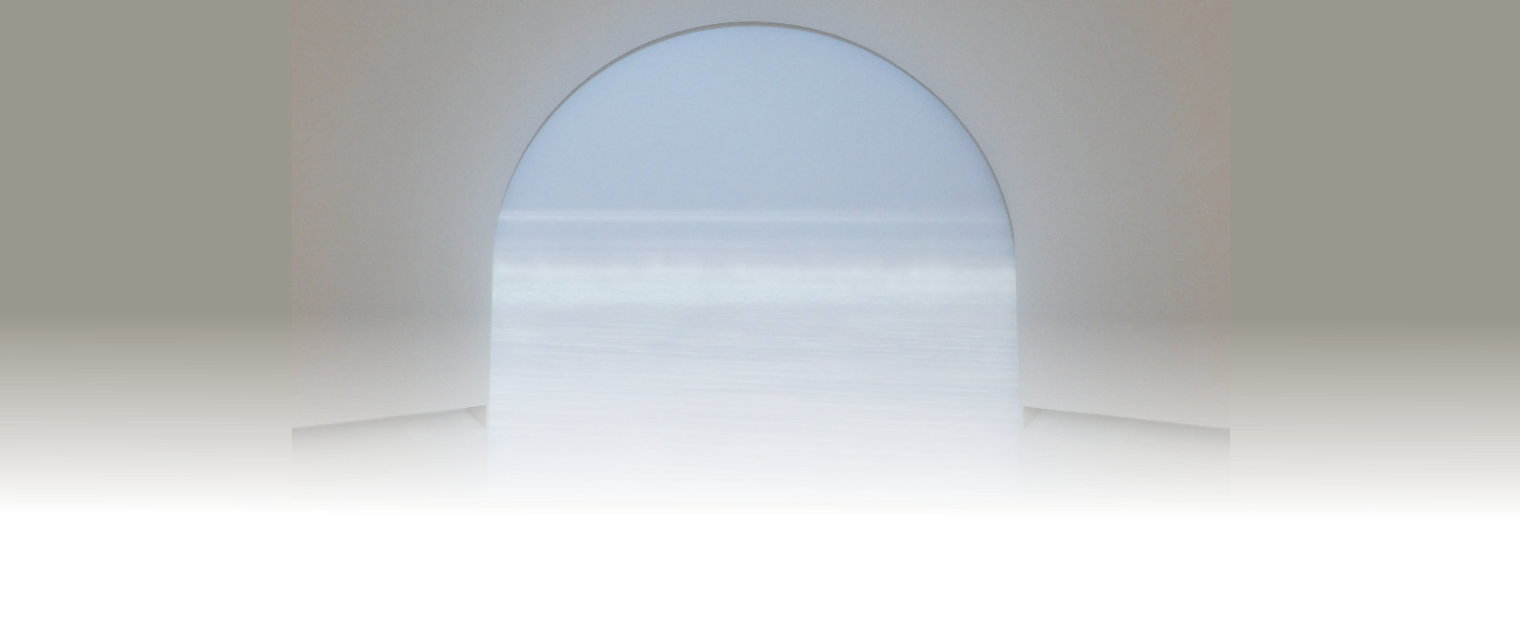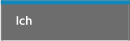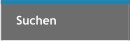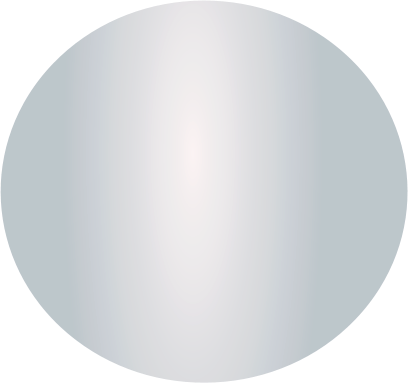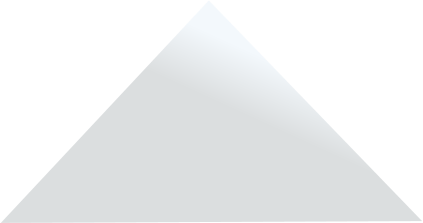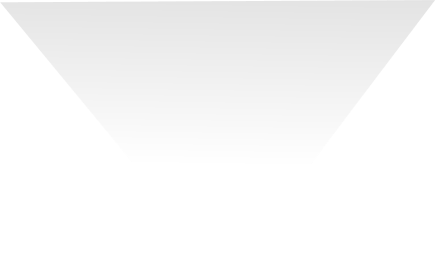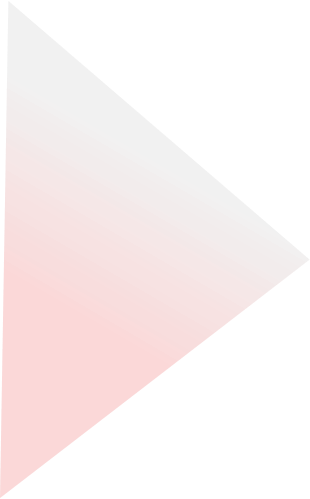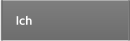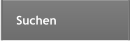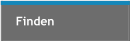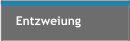Prolog
DIE NULL
m
Anfang
liegt,
was
auch
mich
bedingt,
liegt
bereits
was
mich
fragen
lässt,
warum
ist
überhaupt
Etwas
und
nicht
vielmehr
Nichts.
Diese
Frage
stellt
„Alles“
in
Frage,
auch
Zeit
und
Raum.
Sie
führt
mich
an
die
Grenze
des
Sagbaren.
Darüber
hinaus
ist
mein
Sagen
nichts,
auch
wenn
ich es in Worte fassen möchte.
An
dieser
Grenze
trifft
das
Schweigen,
das
mir
alles
in
Fülle
zu
sagen
verspricht,
auf
mein
Hören,
das
sich
nur
schweigend
der
Leere
öffnen
kann.
Geschenkt
wird
mir
aber
das
Hören
der
Frage
nach
dem
was
ist,
dem
„Etwas“.
Meine
erste
Antwort
ist
dieses
Geschenk
stumm
entgegenzunehmen.
Das
Unsagbare
vom
Sagbaren
geschieden
wird
im
Anfang.
Aber
was
war
vor
dem
Anfang?
Warum
überhaupt
ein
Anfang?
Diese
Fragen
versuchen
vermessen
die
Grenze
zu
überschreiten,
doch
allein,
dass
wir
sie
stellen
können,
zeigt
die
mögliche
Größe
unserer
Art,
die
Großartigkeit,
die
uns
Menschen
geschenkt
wurde.
Aber
muss
nicht
noch
viel
Größeres
in
dem
Geheimnis
liegen,
das
es
uns
ermöglicht,
diese Fragen zu stellen?
Seit
dem
Anfang
wird
Zeit
und
Raum
im
Sein
gehalten,
entfalten
sich
die
Elemente
in
den
Beziehungen
zueinander,
werden
aus
den
Bewegungen
jeden
Augenblick
neu
die
Gestalten.
Auch
wenn
vor
einem
Anfang
alles
in
sich
vollkommen
war,
so
war
noch
nicht
das
Werden
des
Anderen,
war
noch
nicht
die
Freiheit
im
Geschaffenen,
war
noch
nicht
die
Gestaltwerdung
durch
das
Geschaffene.
Erst
das
Werden
bringt
zur
Entfaltung,
was
im
Ruhenden
immer
war,
bringt
das
Grenzenlose auch in das Erschaffene und damit auch zu uns.
Werden
wir
mit
dem
Werden
in
Zeit
und
Raum
in
die
gestaltwerdenden
Möglichkeiten
des
Seins
hinein
entgrenzt
und
wird
uns
geschenkt,
das
Begrenzte
ins
Grenzenlose
zu
überschreiten?
Werden
wir
aufgenommen
in
eine
sich
entfaltende
Einheit.
Entfaltet
sich
mit
der
Vielfalt
des
Seins
auch
das
ganz
„Andere“
selbst,
das
was
schuf?
Ist
das
Werden
der
Gestalt
für
uns
so
viel
weiter
als
weit
und
zugleich uns so viel näher als nah, weiter und näher als wir meinen.
Es
ist
die
Zeit,
wir
versuchen
sie
zu
fassen
in
den
Zahlen.
Es
ist
der
Raum,
wir
versuchen
ihn
zu
umgreifen
im
Maß
der
Symbole.
Die
Verbundenheit
von
Zeit
und
Raum
findet
sich
gespiegelt
in
Zahlensymbolen.
Mit
ihnen
lassen
sich
die
Elemente
des
Seins
bezeichnen.
Ihre
Beziehungen
zueinander
geben
die
Möglichkeit
das
Sein
zu
ordnen,
ihre
Zuordnungen
in
der
Zeit
zeigen
uns
die
Bewegungen im Werden zu den Gestalten.
0
I
Ist
der
Anfang,
den
wir
kennen,
der
Einzige?
Ist
unser
Universum
das
Einzige?
Ist
unsere
Welt
die
Einzige?
Ist
die
Welt
überhaupt
in
seiner
Gestalt
auch
nur
annähert
für
uns
zu
fassen?
ist
alles
nur
ein winziger Aspekt des Unbegrenten?
Leibnitz
fragte
1714
„warum
es
eher
Etwas
als
Nichts
gibt.“
Die
Frage
ergab
sich
aus
der
Annahme,
dass
nichts
ohne
zureichenden
Grund
geschaffen
wurde,
dass
nichts
ohne
Ursache
geschieht.
Leibnitz
sah
den
letzten
Grund,
dass
die
Welt
da
ist
und
so
da ist, wie sie ist, in Gott.
Schelling
nannte
diesen
fundamentalen
Grund
„das
Absolute“.
Paul
Natorp
führte
1920/21
aus:
„Darin
stecken
alle
Wunder,
das
Wunder
aller
Wunder,
daß
etwas
überhaupt
‘ist‘.
Heidegger,
der
‚kurzsichtige
Tiefdenker‘,
brachte
das
reine
Nichts
als
Gegenmöglichkeit
des
Seienden
ins
metaphysische
Spiel.
Die
„Hineingehaltenheit
in
das
Nichts“
ist
der
angstauslösende Faktor im Da-sein.
Daran
schließen
sich
für
mich
die
Fragen
an:
Ist
das
was
ist
ein
gesegnetes
oder
ein
verfluchtes
Geschenk?
Und
wer,
und
wie
kann
es
uns
zum
Guten gereichen?
In
vier
Symphonien
wage
ich
das
Experiment.
Sie
werden
komponiert
aus den 3 Grundelementen: Einheit, Dualität, Ich.
Diese
werden
4-fach
zueinander
in
Beziehung
gesetzt,
um
sich
damit
12-
fach
zu
entfalten.
Die
12-fache
Entfaltung
wird
gespiegelt
in
12
Seinsbereichen,
um
damit
in
144
Themen
aufzuscheinen.
Das
Ganze
des
Sagbaren
wird
gehalten
im
Unsagbaren,
symbolisiert
durch
die
Nichtzahl
„O“,
die
als
Prolog
vor
den
Anfang,
und
der
Nichtzahl
„Unendlich“,
die
als
Epilog
nach
dem
Ende
gesetzt
wird.
Die
Gestalten,
die
sich
zeigen,
werden
damit
eingebunden
in
die
gestaltlose
Gestalt
vor
und nach dem Sein.
Das
Ganze
ist
als
ein
Gerüst,
als
ein
Netzwerk,
zu
begreifen,
das
auch
den
Sonnenzyklus
mit
seinem
12-
fachen
Rhythmus
der
12
Monate,
die
2
x
12
Stunden
des
Tages
und
der
Nacht,
wie
auch
die
Symbolzahl
für
das
Unendliche,
144
(12
x
12),
aufgreift.
Die
Gestalten
sind
durchdrungen
vom
Rhythmus,
der
die
3
mit
der
4
verbindet.
Aus
diesen
Zahlen
ergibt
sich
multipliziert
wiederum
die
Zahl
12,
addiert
die
Zahl
7.
Mit
der
7
wird
auch
der
Wochenrhythmus
mit
7
Tagen,
der
Mondzyklus
mit
4
x
7
Tagen
(28
=1+2+3+4+5+6+7)
und
der
Lebensrhythmus,
mit
dem
jeweiligen
Vielfachen
von
7
in
die
Gestalten
aufgenommen.
84
(3
x
28)
kann dann als Symbolzahl für ein langes Erdenleben dienen.
Die
Struktur
des
Seins
auf
das
Unsagbare
hin
zusammenzufügen,
seine
Elemente
zu
verknüpfen,
das
Zusammenwirken
und
die
Verbundenheit
von
Allem
zu
Allem
und
zum
Ganzen
hin
sichtbar
zu
machen,
den
Einklang,
gleich
einer
Symphonie,
empfindbar
zu
gestalten,
ungewohnte
und
schmerzhafte
Töne
und
Geräusche
nicht
auszusparen
und
unser
beschränktes
Mitwirken
und
Versagen
einzubeziehen,
dies
ist
der
vermessene Weg.
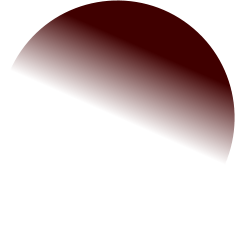
Alle
Verbundenheiten
zu
erkennen
ist
vermessen.
Wir
können
sie
nur
in
einzelnen
Bereiche
erfassen.
Dabei
gilt
es
aber
nicht
aus
den
Augen
zu
verlieren,
dass
auch
die
nichterkannten
Beziehungen
da
sind
und
wirken.
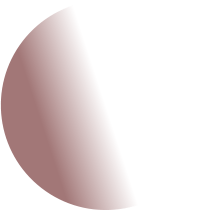
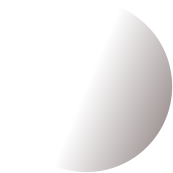
Die
Zusammenschau
zeigt
12
konzentrische
Kreise,
die
jeweils
in
12
Kreisabschnitte
eingeteilt
sind.
Aus
dem
innersten
Kreis
(Die
Null
–
„Vor
dem
Anfang“)
treten
auf
jeder
Kreisebene
die
Zahlen
hervor,
wobei
auf
jedem
der
12
Kreisabschnitte
die
Zahlen
auf
die
nächste
Kreisschale
gehoben
werden,
solange,
bis
die
12.
Ebene,
der
äußerste
Kreis
(Das
Unendliche
–
„Nach
dem
Ende“),
erreicht
wird.
Hier
fallen
die
12
Kreisabschnitte
mit
den
12
Kreisschalen
zusammen
(12
mal
12
=
144
-
Symbol
des
Unendlichen).
Damit
ist
die
gesamte
Gestalt
mit
144
Feldern
eröffnet,
in
der
sich
144
Themen
entfalten
können.
In
der
Zahl
144
ist
auch
der
Endpunkt
der
12-teiligen
Reihe
1,
1,
2,
3,
5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 erreicht.
1
1
Die
Fibonacci-Folge
ist
die
unendliche
Folge
von
natürlichen
Zahlen,
die
zweimal
mit
der
Zahl
1
beginnt.
Im
Anschluss
ergibt
jeweils
die
Summe
zweier
aufeinanderfolgender
Zahlen
die
unmittelbar danach folgende Zahl.
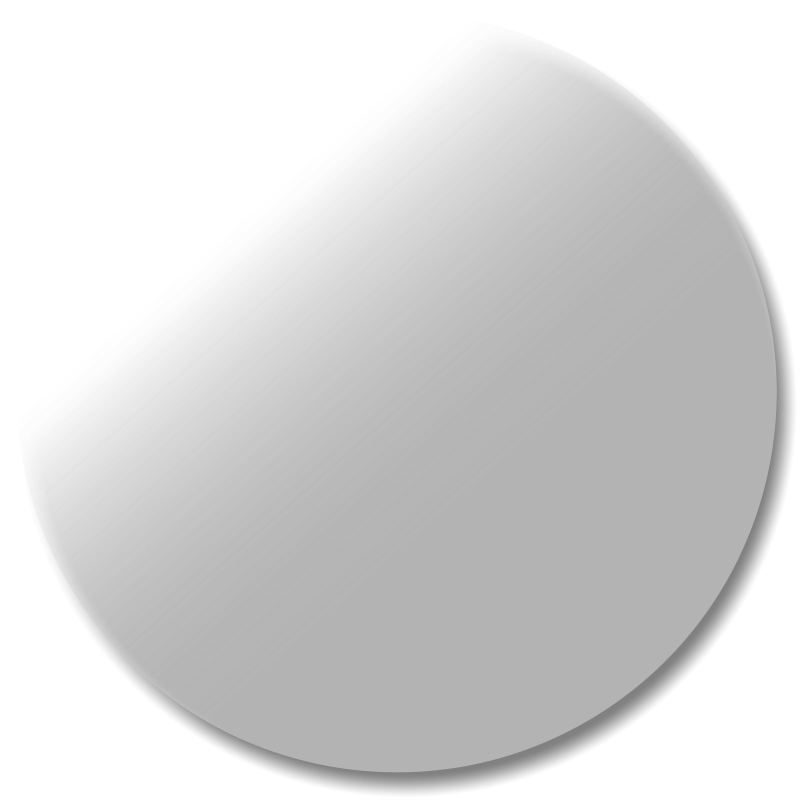
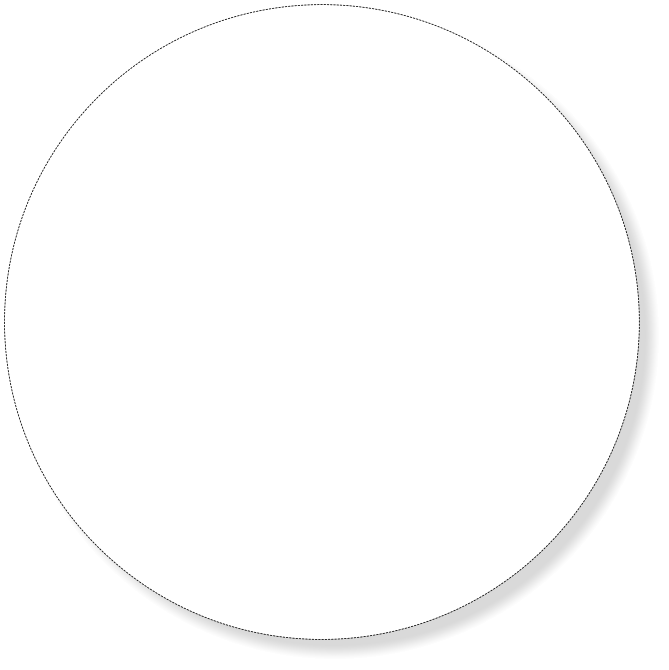
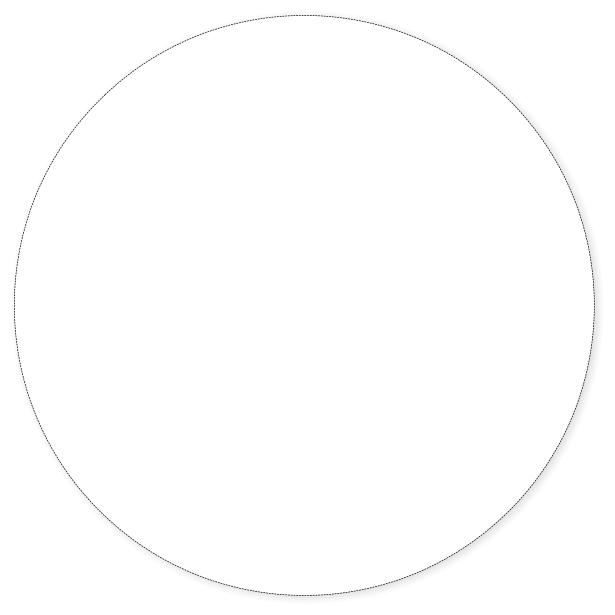
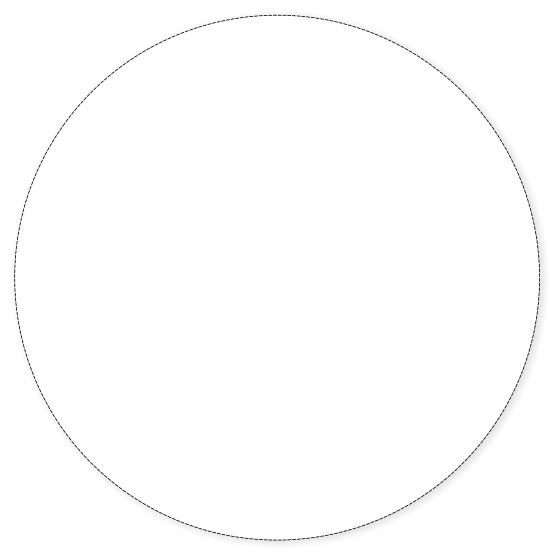
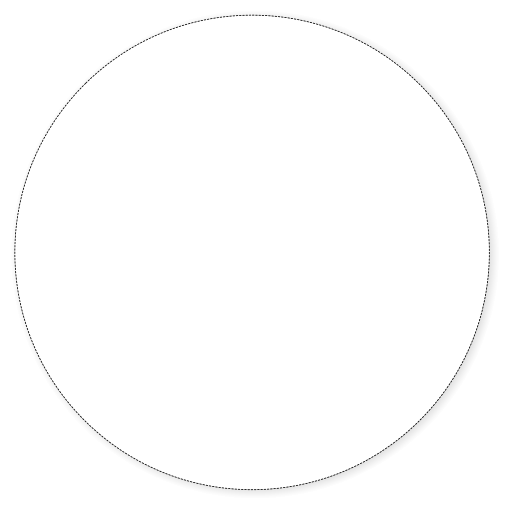
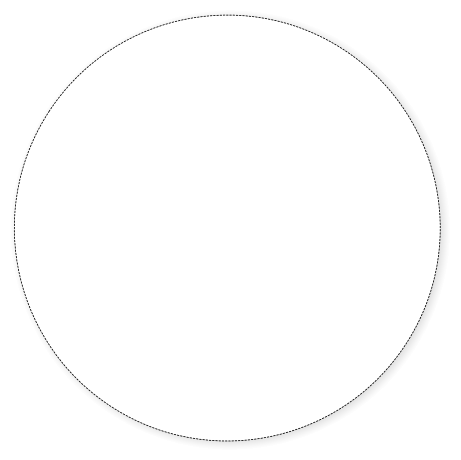

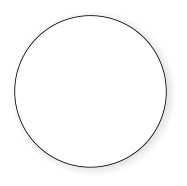
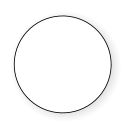
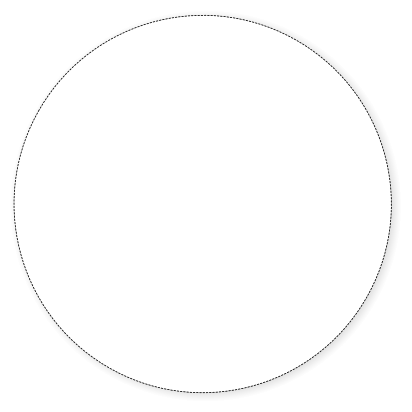
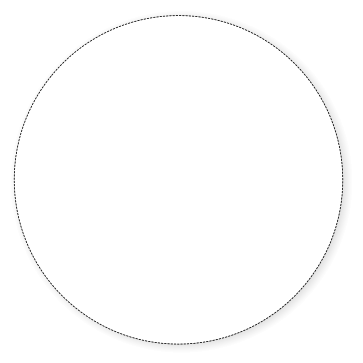
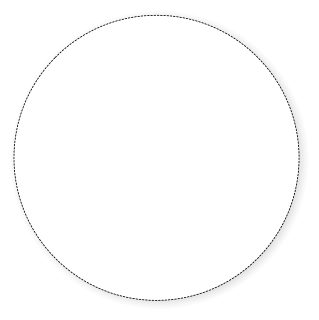
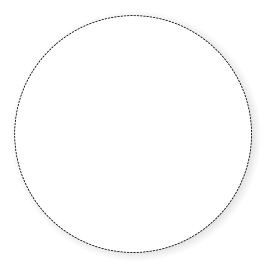
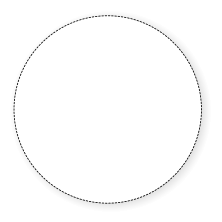
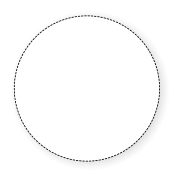
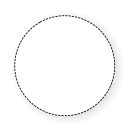
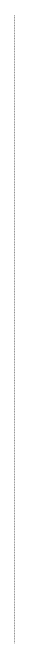
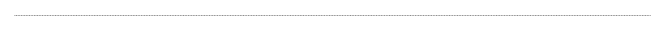
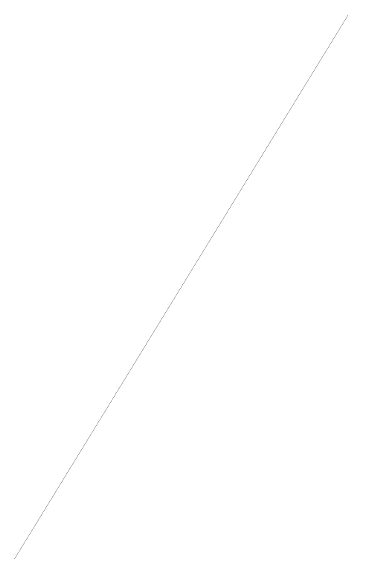
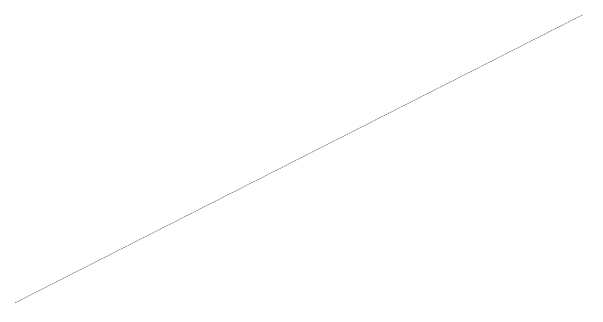
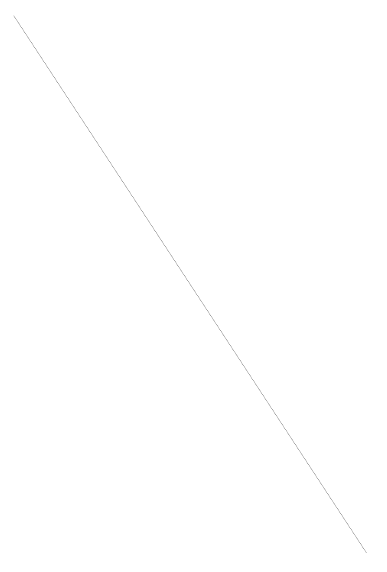
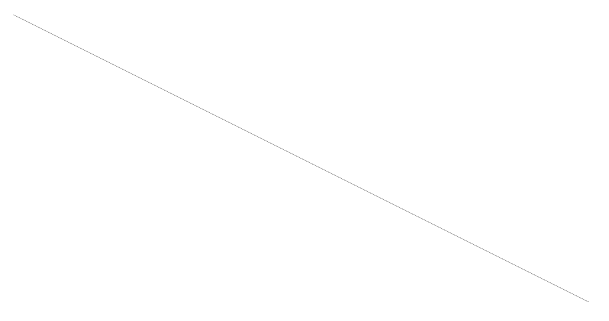











Die Entfaltung von 0 bis
ꝏ
12 x12=144
Α
Ω

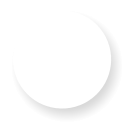
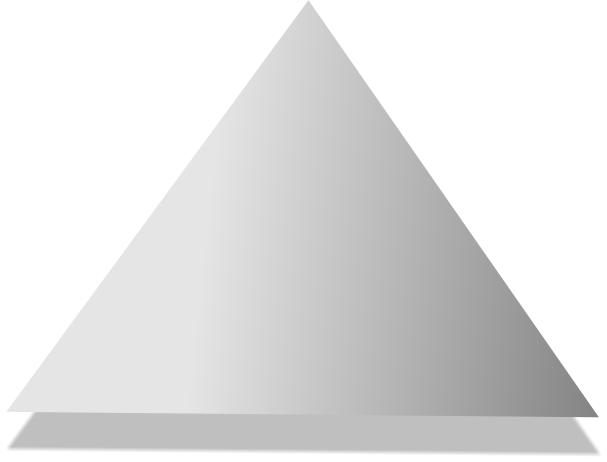
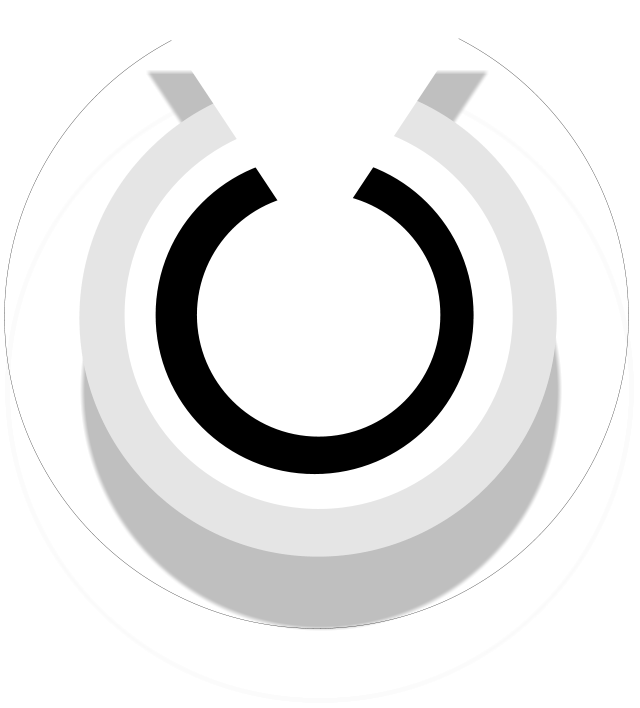
OFFENES GEHEIMNIS
RAUMZEIT
LICHT
G O T T
EINHEIT
DUALITÄT
MENSCH
WELT
WELT
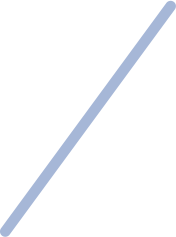

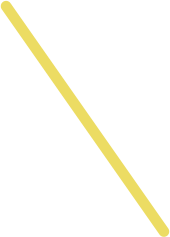
EMPFINDEN
DENKEN
TUN & LASSEN
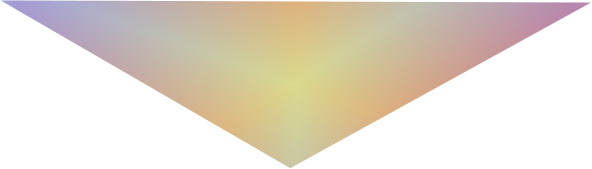
DIE
ELEMENTE
WERDEN IN
BEZIEHUNGEN
&
BEWEGUNGEN
ZU
GESTALTEN
IN DEN
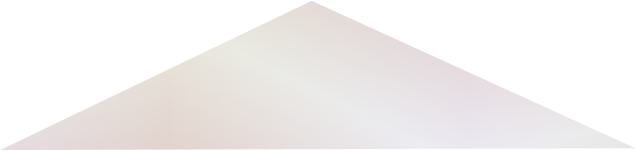
KÜNSTEN
WISSENSCHAFTEN
POLITIKEN
ZUSAMMENSCHAU
I
n
der
Einheit
spiegelt
sich
das
Bedingungslose
im
Erfahrbaren
wider.
Doch
die
Einheit
ist
stets
gefährdet,
nicht
zu
fassen.
Sie
war
schon
verloren,
als
sie
im
Anfang
ins
Sein
geworfen
worden
war.
Im
ersten
Augenblick
wurde
aus
der
Einfalt,
die
weder
ist
noch
nicht
ist,
das
„Nicht – Nichts“. Das Ewige wird, wird im Etwas.
Von
da
an
sucht
das
Verlorene,
das
Vollkommene,
das
sich
lückenlos
Ergänzende,
das
alle
Grenzen
Sprengende,
das
sich
bedingungslos
Erfüllende,
wiederzufinden.
Es
wird
das
Sein
gesucht,
das
den
Raum
und
die
Zeit
nicht
mehr
zu
beachten
braucht.
Die
Symbole
der
Einheit
sind
die
Zahl
Eins,
der
Kreis,
die
Kugel.
Wir
wissen
nicht
den
Anfang
und
das
Ende
des
Kreises,
doch
wo
wir
den
Weg
auch
beginnen,
er
führt
uns
immer
zum
Anfang
zurück.
Anfang
und
Ende
sind
verbunden
im
Kreis.
Unendlich
viele
Kreisschalen
finden
in
der
gleichen
Mitte
ihren
Halt.
Und
ist
eine
Kugel
nur
unendlich
groß,
so
ist
jeder
ihrer
Raumpunkte
zugleich
allgegenwärtiger
Mittelpunkt.
Die
Einheit
des
ersten
Seins
bildet,
mit
dem
Ursprung
vor
allem
Sein,
die
erste entfaltete Gestalt.
Wo
können
wir
diese
Gestalt
der
Einheit
in
unserem
Dasein
entdecken?
Wo
ist
diese
Einfalt,
diese
so
vollkommene
Form,
durchlässig
zu
uns
hin?
Wo
zeigt
sich
der
Abglanz
des
Lichts
aus
dem
Urgrund?
Wann
können
wir
hinein
hören
in
die
Stille
des
Einen?
Wie
können wir durchlässig werden für das Geheimnis der Einheit?
Wie
die
Einheit
verschwindet,
wenn
ich
sie
zu
fassen
versuche,
so
verliert
sich
auch
die
Zeit
zwischen
dem
„Nicht
–
Mehr“
und
dem
„Noch
–
Nicht“.
Aber
im
geglückten
Augenblick
ist
die
Einheit
vor
dem
Anfang
zu
erahnen.
Dann
scheint
der
Mythos
des
Paradieses
auf,
dann
sind wir mehr als nur Erinnerung und mehr als nur Hoffnung.
In
der
Stille
zwischen
den
Tönen,
in
der
Leere
zwischen
den
Formen,
in
den
Träumen
zwischen
dem
Wachen,
kann
die
Durchlässigkeit
der
Grenze
erfahrbar
werden.
Gelänge
es
das
Dazwischen
zuzulassen,
sich
in
das
Dazwischen
fallen
zu
lassen,
die
Grenzen
zur
Einheit
öffneten
sich
und
uns
könnte
geschenkt
werden,
was
längst
verloren
geglaubt.
Erkennbar
ist
für
uns,
dass
alles
im
Sein
mit
allem
verbunden
ist,
dass
im
Geflecht
des
Seins
bereits
geringe
Veränderungen
die
Richtung
im
Ganzen
beeinflussen,
dass
die
Wirklichkeit
offen
ist
für
unendliche
Möglichkeiten.
1
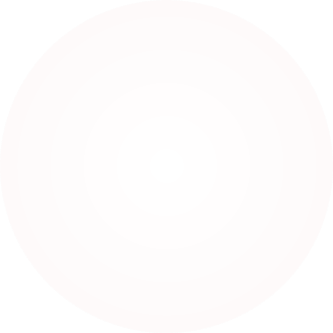
Von der Einheit zum Ich
1. Satz
Die Einheit
I. SYMPHONIE
Johann Sebastian Bach - Kunst der Fuge
„Aus zwölf Tönen . . . wird ein ganzer musikalischer Kosmos.
Dabei
geht
es
Bach
nicht
nur
um
die
Einheit,
sondern
zugleich
um
die
Mannigfaltigkeit
im
Umgang
mit
dem
Ausgangsmaterial:
Nicht
nur
ist
Alles
aus
Einem
gemacht;
vielmehr
birgt
dieses
Eine die Möglichkeit zu Allem.“
Ludwig van Beethoven
Seine
Kompositionen
sollen
„frei
und
ungebunden“
zugleich
sein.
Es
ist
das
„Ringen
des
gottbegabten
Künstlers,
Gegensätze zu vereinen
[CUSANUS]
.“
Martin Geck - Beethoven - S. 56
Markus
Gabriel
schreibt
in
„Warum
es
die
Welt
nicht
gibt“
S.
20/21),
dass
es
falsch
ist
zu
denken,
dass
alles
mit
allem
zusammenhängt,
dass
es
keine
Regel
oder
Weltformel
gibt,
die
alles
beschreibt
und
diese auch gar nicht existieren kann.
Für
unser
Erkennen
mögen
die
Verbundenheiten
nicht
existieren,
aber
doch
für
das
Geheimnis,
das
sich ins Sein öffnete. Im Anfang war alles Eines!
Auch
wenn
uns
Maß
und
Ziel
des
Ganzen
noch
verschlossen
bleiben,
so
zeigt
uns
diese
werdende
Gestalt
der
immerwährenden
Einheit
bereits
Wegmarken,
die
unsere
Gestaltwerdung
beeinflussen.
Die
Gestalt
der
Einheit
ist
im
Werden.
1

2
m
Dasein
ist
Spaltung,
mit
dem
Licht
war
auch
der
Schatten,
war
Weiß
und
Schwarz.
Die
Zeit
teilt.
Die
Einheit
wird
zum
„Noch
–
Nicht“
und
„Nicht
–
Mehr“.
Die
Eins
wird
weiter
gezählt.
Es
gibt
die
Eins
und
die
Zwei,
das
Wenn
und
das
Dann,
das
Entweder
-
Oder
das
An
und
das
Aus, das Ja und das Nein, das Werden und Vergehen.
Die
Einheit
ist
in
den
Raum
der
Möglichkeiten,
in
die
Zeit
der
Notwendigkeiten,
in
den
Rahmen
der
Entfaltung
gelangt.
Die
Freiheit
beginnt
ihren
Weg
durch
das
Sein.
Angelegt
in
der
ersten
Trennung
ist
schon
die
zweite,
und
in
jedem
der
Teile
sind
die
Möglichkeiten
der
eigenen
Entfaltungen
mitgegeben,
in
einem
Gegeneinander,
in
einem
Miteinander.
Die
in
die
Materie
eingeschriebenen
Gesetze
beginnen
ihre
Wirkungen
zu
entfalten,
drängen
in
immer
neue
Gestalten
hinein,
die
stets
mehr
sind
als
nur
die
Summe
ihrer
Teile.
Die
Einheit
wirkt
in
und
durch
ihre
Entfaltungen und sucht sich immer neu zu finden.
Die
Dualitäten,
sie
gehören
zum
Atem,
zum
Puls
des
Seins,
zum
Willen
zum
Leben,
zur
Ordnung
des
Lebendigen.
Chaos
quillt
hervor,
aber
stets
auch
neue
Ordnungen.
Ein
wechselseitiges
Durchdringen,
in
dem
das
Lebendige gefasst und das Gefasste lebendig bleiben kann.
Ordnung
und
Chaos
entstanden
ohne
uns,
wie
auch
Chaos
und
Ordnung
ohne
uns
zerfallen;
aber,
dass
dies
für
uns
staunend
erfahrbar
wird,
ist
das
nicht
Wunder
genug?
Leben
wurde
möglich,
getriebenes
Sein,
bis
sich
Leben
entwickelte,
das
selber
den
Trieb
kennt.
Passives
wurde
um
Aktives
erweitert,
so
dass
aus
der
geschehenen
Entfaltung,
Entfaltung
wurde, die mitgestaltet.
Doch
was
ist
denn
aktiv,
was
ist
denn
passiv?
Ich
vermeine
es
zu
wissen,
doch
ich
beginne
mit
dieser
Frage
in
mir
selbst,
wo
die
Ursprünge
zum
Handeln
oft
geheimnisvoll
im
Dunkeln
bleiben.
Dann
aber
kann,
was
für
mich
aktiv
erscheint,
durch
das
in
der
Vergangenheit
oder Zukunft Verborgene, mir bereits auferlegt sein.
Im
Sein
ist
der
Prozess
verankert,
der
zwischen
aktiv
und
passiv
vermittelt,
der
wechselseitig
stets
neu
erkundet,
wie
aus
den
Notwendigkeiten
Möglichkeiten
werden
können.
Doch
alle
Möglichkeiten
sind
vielfach
begrenzt,
werden
aus
den
Gesetzen
des
Daseins
nicht
entlassen.
Damit
ist
in
jeder
Entfaltung
notwendig
auch
Trennung,
in
jedem
Gewinn
und
Zuwachs
stets
auch
Verlust
und
Mangel.
Es ist ein Werden und Vergehen im Atem der geschaffenen Zeit.
2. Satz
Die Dualität
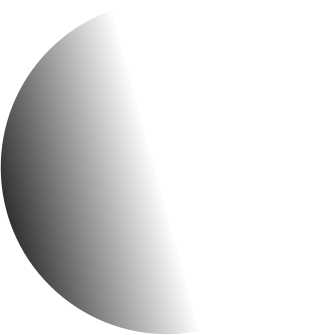

I
Die binäre Digitaltechnik umfasst nur
zwei diskrete Signalzustände. Diese
werden üblicherweise als logisch null (0)
und als logisch eins (1) bezeichnet.
Polaritäten - Gegensätze
3
3. Satz
Das Ich
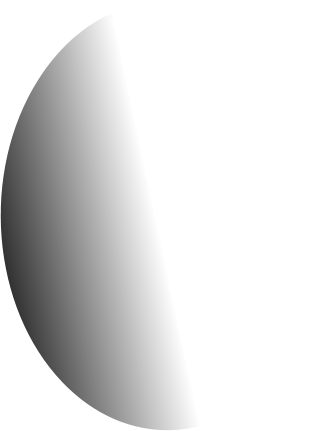
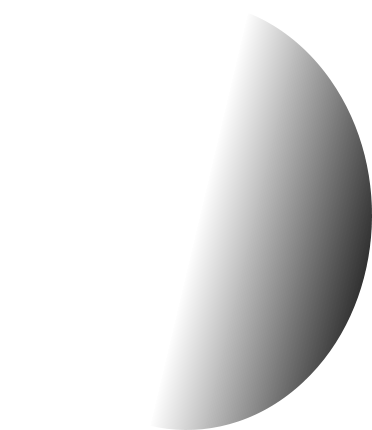
W
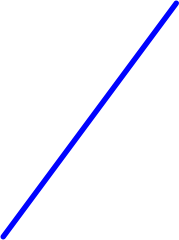

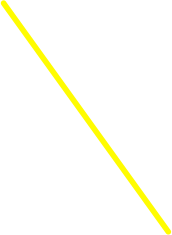
ieviel
Teilung
und
Entfaltung,
bis
der
Mensch
war,
der
sich
seines
Ichs
bewusst
wurde.
Das
Licht
des
Ursprungs
fand
seinen
Widerschein
im
Element
des
Ichs,
im
Ich
der
Dreiheit,
von
Empfinden,
Denken,
Tun
und
Lassen.
Eine
neue
Gestalt,
eine
neue
Ordnung
in
der
uns
erkennbaren
Welt,
in
der
die
Elemente
der
Einheit
und
Dualität
nicht
ausgelöscht,
sondern
gebunden
wurden
und
sich
stets
neu
binden.
Das
Ich
ist
geworden,
ohne
selbst
Einfluss
auf
die
Gesetze
des
Werdens
zu
erlangen,
es
ist
im
Dasein,
ohne
gefragt
worden
zu
sein,
es
ist
ein
Ergebnis
der
Prozesse
des Daseins, des passiven Geschehens des Seins.
Doch
dem
Ich
sind
Möglichkeiten
der
Entfaltung
zugewachsen.
Es
kann
etwas
über
die
Gesetze
des
Werdens,
etwas
über
sich
selbst,
etwas
über
seine Beziehungen und Bewegungen in der Gestaltwerdung aussagen.
Ich,
weniger
als
ein
Lächeln
lang
in
der
Zeit,
im
Dasein
ein
winziger
Samen
auf
der
Erde,
ein
ungleich
noch
viel
Kleineres
im
denkbaren
Raum,
ein
Nichts
vor
dem
Geheimnis
vor
und
nach
dem
Sein.
Und
doch
ist alles was ist, doch nur in, mit und durch mein Ich Sein für mich.
ICH,
das
Wort
ist
eingebunden
in
das
Wort
L
ICH
T.
Das
ICH
leuchtet
auf
im
Licht,
das
dem
Dunkel
des
offenen
Geheimnisses
entsprang.
Das
„L“
symbolisiert
das
Leben,
als
Beginn,
das
„T“
den
Tod,
das
Ende
des
raumzeitlichen
Seins.
Ich
bin
mir
bewusst,
dass
ich
bin,
ich
bin
ich.
Immer
wenn
ich
„ich“
sage,
bin
ich
einmalig,
unvertretbar.
Ich
bin
der
Punkt,
von
dem
aus
ich
meine
Welt
empfinde,
denke
und
in
ihr
handle.
Aus
meiner
Ichperspektive
ordne
ich
alles,
was
es
gibt.
Ich
beobachte
mich
als
eine
werdende
Person,
die
anderen
„Ichs“,
die
mich
umgebende
Welt,
ich
nehme
meine
Gedanken,
meine
Wünsche,
meine
Hoffnungen,
das,
was
mir
geschieht
und
was
ich
wirke,
wahr.
Ich
kann
aus
dem
Ganzen
meiner
Einmaligkeit
heraus
das
sich
mir
öffnende
Ganze
bis
zu
den
mir
gesetzten
Grenzen
wahrnehmen.
Ich
nehme
aber
auch
wahr,
dass
ich
nur
ein
Tropfen
im
Meer,
ein
Staubkorn
irgendwo
in
der
Unermesslichkeit
des
Universums,
nur
eine
Randerscheinung
bin.
Wäre
etwas
anders,
wenn
ich
nicht
wäre?
Und
doch,
ohne
mein
unvertretbares
Ich
wäre
die
Welt
eine
andere.
Ist
das
nicht
ein
Hinweis,
dass auch Ich gewollt bin?
Das
Zahlensymbol
des
Dreiecks
fügt
dem
geteilten
Kreis
ein
Drittes
hinzu,
verlässt
die
Harmonie
des
Kreises,
verliert
die
einfache
Gegensätzlichkeit
des
geteilten
Einen
und
findet
sich
in
der
Verbundenheit
und
Getrenntheit
von
Tun,
Empfinden
und
Denken
wieder.
Drei
Seiten,
wie
im
Dreieck
miteinander
verbunden,
und
keine
darf fehlen, keine darf dominieren, soll das Ich nicht verloren gehen.

Gegensätze - Polaritäten
Nikolaus von Kues
„coincidentia absconditi et manifesti“
„Zusammenfall von Verborgenheit und Offenbarkeit“
Das
farblose,
alles
in
sich
bergende
Licht,
es
wird
im
Dreieck
in
Farben
zerlegt,
in
das
Blau
des
Empfindens,
dem
Dunkel
nah,
in
das
Rot
des
Tuns,
dem
Dasein
eingefleischt,
in
das
Gelb
des
Denkens,
ein
Widerschein
des
Lichts.
In
jeder
Farbe
schwingen
die
anderen
mit,
aus
ihrem
Zueinander,
ihren
Mischungen,
ihrem
Gegeneinander,
wird
das
Bild des Ichs gestaltet, die Gestalt, die ich im Sehen bin.
Ein
Zusammenspiel,
in
dem
sich
mit
dem
Licht
auch
der
Schatten
zeigt,
ein
Zusammenklang,
der
mir
aber
auch
die
Gestalt
der
Einheit
vor
der
Dualität erfahrbar macht.
Rot,
die
Farbe
des
Tuns
und
Lassens,
des
Augenblicks,
sie
verlangt
Entscheidungen
an
der
Schwelle
von
den
Erinnerungen
des
„Nicht
-
mehr“
zu
den
Verheißungen
des
„Noch
-
nicht“.
Rot
tritt
heraus
aus
dem
Blau,
das
dem
tiefen
Raum
der
gewordenen
Empfindungen
verhaftet
ist.
Rot
nimmt
das
Gelb
auf,
das
aus
den
weiten
Räumen
des
werdenden
Denkens entgegenkommt.
Auch
Töne
sind
durch
ein
dreifaches,
Höhe,
Stärke
und
Dauer
und
erscheinen
in
Dur-
und
Moll-Dreiklängen
im
Zusammenklang.
Aus
ihnen
wird
im
Erklingen
und
Verklingen,
im
zu-
und
miteinander
eine
Gestalt,
die
sich
von
Augenblick
zu
Augenblick
neu
entfaltet,
eine
Gestalt des Seins, die ich im Hören bin.
Im
Ich
ist
Empfangen
und
Geben.
Es
ist
Empfinden,
das
uns
entgegenkommt
und
Empfinden,
das
wir,
aus
unserem
Wollen
geboren,
weitergeben.
Es
ist
Tun
als
unsere
Gabe
im
Handeln
und
Tun,
das
uns
geschieht.
Es
ist
Denken
als
unser
Nach-
und
Vordenken
in
die
Gestalten unseres Seins hinein.
In
der
Freiheit
und
Bedingtheit
des
Empfangens,
in
der
Möglichkeit
und
Notwendigkeit
des
Gebens,
ist
das
Ich
eingebunden.
Aber
wo
findet
sich
der
Plan
für
die
Zuordnung
der
Seiten
des
Ichs,
wo
ist
der
Schlüssel
für
den
Zusammenklang
der
Zeichen,
was
ist
es
das
die
Musik
des
Ichs
immer neu zu öffnen vermag?
Wie
kann
das
Empfinden
den
Einklang
mit
dem
Denken,
wie
das
Denken
seinen
Ausdruck
im
Tun
finden?
Und
wie
kann
aufgeschlossen
werden,
inwieweit
das
Denken
geprägt
wird
von
meiner
erfahrenen
aktiven und passiven Leiblichkeit ?
Fragen,
die
aus
dem
Gewordenen
uns
als
Gewordene,
Gestalten
suchen
lassen, die eingebunden bleiben in das Ganze.
Es
ist
Suchen
und
Finden
in
den
Dimensionen
des
geschaffenen
Raumes.
3
4
Vom Suchen
zum
Finden
1. Satz
Suchen
II. SYMPHONIE
as
Ich
sucht
im
Geflecht
von
Tun,
Empfinden
und
Denken
ein
Viertes,
etwas,
das
die
drei
Seiten
des
Elements
„Ich“
zu
binden
vermag,
etwas
das
Orientierung
gibt
in
einem
Anderen.
Kenn
ich
auch
die
Seiten
des
Ichs,
so
fehlt doch noch das, was sie zueinander binden könnte.
Das
Ich
ist
für
das
Ich
die
Mitte
des
Daseins,
das
spürt,
dass
die
Mitte
des
Seins
woanders
ist.
Diese
Mitte
wird
gesucht
im
Einenden,
das
dem
Ich
den Zugang zum Urgrund und Zielgrund seiner Dreiheit erhoffen lässt.
Mit
dem
Bewusstsein
des
eigenen
Ichs
entstanden
in
unzähligen
Entfaltungsprozessen
die
Erfahrungen
einer
ursprünglichen
Einheit.
Angestoßen
durch
die
Triebe,
werden
im
Sehen,
Hören,
Spüren,
Schmecken
und
Riechen,
im
Not-wendenden
Tun
des
Daseins
und
im
denkenden
Ordnen,
die
Gestalten
der
Einheit
immer
neu
gesucht.
Und
suchen
wir
die
äußerste
Nähe,
so
zeigt
sich
auch
der
Weg
zur
innersten
Weite.
Das
Ich
ahnt
dann
den
Klang,
das
Wort,
das
Licht,
die
uns
aus
der
Mitte
entgegenkommen.
Das
Zusammenfallen
des
Getrennten
wird
uns
angekündigt.
Im
Ich
ist
die
Hoffnung
verankert,
im
Strudel
des
Daseins
nicht
verloren
zu
gehen.
Aus
dieser
Hoffnung
werden
Darstellungen
in
Gestik,
in
Bildern,
in
Tönen.
Es
werden
Sprachen,
als
Gestalten,
die
wir
im
Denken
sind,
Melodien,
die
unserem
Empfinden
Ausdruck
verleihen.
Und
auch
im
fortwährenden
Experimentieren,
im
Versuch
und
Irrtum,
in
den
Regeln
der
„Wenn
-
Dann“
Beziehungen,
geschieht
ein
stetiges
Ringen
um
die gesuchte Gestalt.
In
allem
bilden
wir
das
„Nicht
–
Verfügbare“,
das
uns
Bedingende
in
uns
nach
und
geben
ihm
Namen,
Namen,
die
das
Unauslöschliche
bannen,
das
Unfassbare
festhalten
möchten,
Namen,
die
unsere
Sprachen
dafür
gefunden
haben.
Wie
soll
ich
es
anders
nennen,
als
mit
dem
Namen,
der
mir in meiner Sprache überliefert wurde:
Gott.
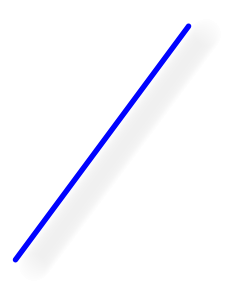
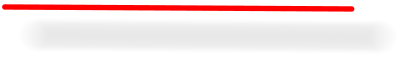
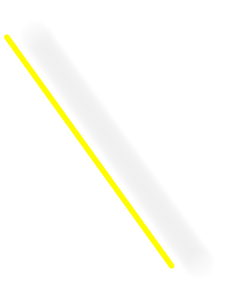
D
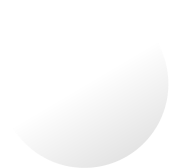
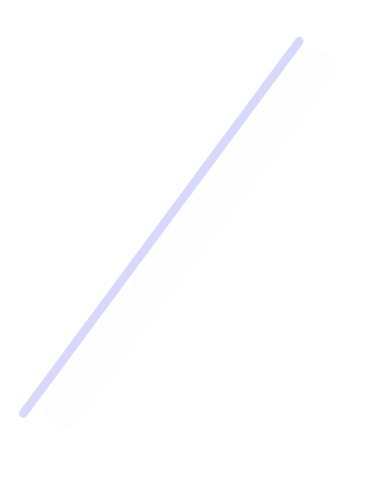
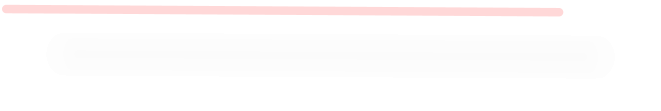
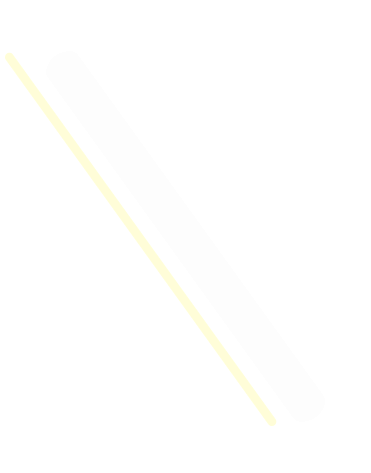
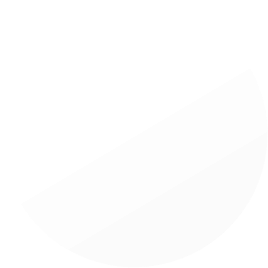
„Die
Philosophie
trachtet,
das
erlösende
Wort
zu
finden,
das
ist
das
Wort,
das
uns
endlich
erlaubt,
das
zu
fassen,
was
bis
jetzt immer, ungreifbar, unser Bewußtsein belastet hat.“
Ludwig Wittgenstein
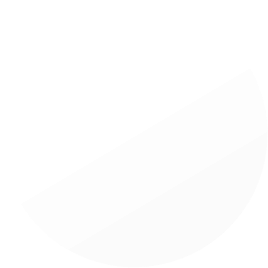
Lass'
uns
nun
sehen,
ob
der
Name
«theos»
oder
«Gott»
uns
Unterstützung
hierzu
gibt.
Der
Name
«theos»
selbst
ist
nämlich
nicht
der
Name
Gottes,
der
jede
Vorstellung
übertrifft.
Denn
was
nicht
erfasst
werden
kann,
bleibt
unsagbar.
Aussprechen
heißt
nämlich,
eine
innere
Begrifflichkeit
mit
Vokalen
oder
anderen
figurhaften
Zeichen
nach
außen
hin
auszudrücken.
Wenn
also
von
etwas
keine
Ähnlichkeit
erfasst
wird,
bleibt
auch
der
Name
unbekannt.
«Theos»
ist
also
der
Name
Gottes
nur
insofern,
als
er
vom
Menschen
in
dieser
Welt
gesucht
wird.
Der
Gott
Suchende
soll
folglich
aufmerksam
betrachten,
auf
welche
Weise
in
dem
Namen
«theos»
ein
bestimmter
Weg
des
Suchens
eingefaltet
wird,
auf
dem
Gott
so
gefunden
wird,
dass
er
berührt
werden
kann.
«Theos»
hängt
etymologisch
mit
«theoro»
zusammen,
was
«ich
sehe»
und
«ich
laufe»
bedeutet.
Der
Suchende
muss
also
mittels
des
Sehens
laufen,
damit
er
zum
alle
Dinge
sehenden
«theos»
gelangen
kann.
Demnach
trägt
die
Schau
eine
Ähnlichkeit
mit
einem
Weg
in
sich,
den
der
Suchende
zu
wandeln
hat.
Wir
müssen
folglich
die
Natur
der
sinnlichen
Schau
auch
auf
das
Auge
der
vernunfthaften
Schau
ausdehnen
und
aus
dieser
eine
Stufenleiter für den Aufstieg hervorbringen.
Nikolaus von Kues - Vom Gottsuchen - fol.197
5
2. Satz
Spaltung
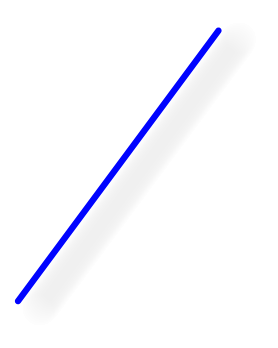
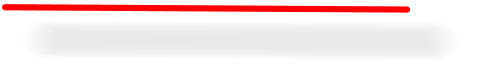
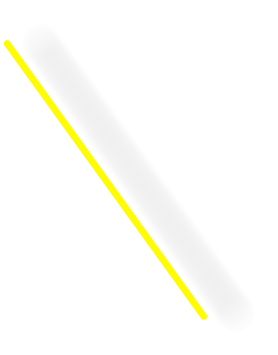
W
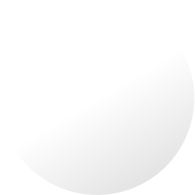
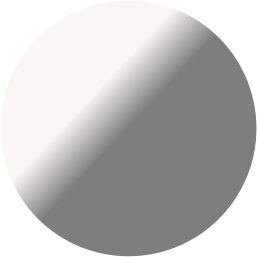
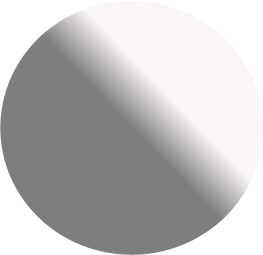
ir
erfahren
in
uns
die
Spaltung,
den
Verlust
der
Einheit,
das
Ja
und
das
Nein.
Es
begegnet
uns
das
immer
Doppelgesichtige
im
Sein
in
allem
was
ist
und
was
wir
sind.
Im
Ich
ist
das
ungefragte
Ja
zum
Leben,
das
erste
Einatmen.
Jedes
Ja
wird
aber
immer
erst
wieder
lebendig
durch
ein
Nein,
das
Ausatmen.
Der
Ur-Zyklus
wird
auch
in
uns
geschlossen.
Doch
jedes
neue
Ja
gleicht
nicht
dem
Vergangenen,
denn
es
kennt
das
Nein,
den
Tod.
Jedes
Ja
und
Nein,
das
von
einer
der
Seiten
des
Ichs
ausgeht,
wird
von
den
Ja
und
Nein
Entscheidungen
der
anderen
Seiten
mit
bedingt.
Erst
im
Erfahren
dieser
Zusammenhängekönnen
wir
uns
als
Einheit
empfinden.
Doch
was
wir
als
Ursache,
was
wir
als
Wirkung
meinen
zu
kennen,
ist
immer
abhängig
von
der
Zufälligkeit
des
Beginns
unseres
Suchens.
Wir
suchen
nach
der
Wahrheit,
den
wahren
Zusammenhängen,
der
Gestalt,
die
alles
mit
aufnimmt;
aber
in
unserer
Verzweiflung,
das
Wahre
zu
verfehlen,
finden
wir
oft
nur
Gründe,
mit
denen
wir
meinen
unsere
erlebte
Vergangenheit
und
unsere
erhoffte
Zukunft
im
Jetzt
rechtfertigen
zu
können.
Zwar
verlieren
wir
uns
immer
wieder
beim
Versuch
uns
zu
finden,
doch
jedes
Verlieren
gibt
schon
den
Anstoß
zu
neuem
Finden,
zum
Finden
einer
veränderten
Gestalt.
Mit
jedem
Tun
können
die
Seitendes
Empfindens
und
Denkens
beschädigt
werden;
aber
auch
in
jedem
Nicht-
Tun
kann
Empfinden
verloren
gehen.
Im
Nicht-Empfinden
kann
Denken
entschwinden,
wie
mit
jedem
Denken
auch
Tun
versäumt
werden
kann.
Im
Leben
ist
der
Tod
stets
gegenwärtig.
Es
ist
die
Frage
nach
seinem
Sinn,
seinem
Wann,
Warum,
Wozu
und
Wohin,
die
uns
drängt
unserem
Leben
Gestalt
zu
geben.
Tod
und
Leben,
sind
aufeinander
bezogen
im
Ich.
Wie
ist
zu
fassen,
was
im
Prozeß
des
Lebens
und
Sterbens
uns
Halt
geben
kann,
wie
zu
fassen,
was
uns
hoffen
läßt,
das
jeder
Tod
immer
wieder
nur
ein
Vorletztes
ist?
Wir
sind
in
der
Zeit
des
Ichs
verloren
in
den
Tod
hinein,
in
der
Zeit
des
Seins
lebendig
im
Werden
des
Gestalt,
aber
erst
im
Sein
ohne
Zeit,
Tod
und
Leben
verlierend,
werden
wir
erfüllt
in
das
Unermessliche
hinein. Leid und Freude ist im Atem dieser „Tod – bewussten“ Zeit.
Schönheit, ist das „uninteressierte Wohlgefallen“. (Kant)
Es ist ein Luxus seine Interessen auszublenden,
um das Schöne zu finden.
„Auch Schönheit der Natur, d. i. ihre Zusammenstimmung mit dem freien Spiele
unserer Erkenntnisvermögen in der Auffassung und Beurteilung ihrer Erscheinung,
kann auf die Art als objektive Zweckmäßigkeit der Natur in ihrem Ganzen, als
System, worin der Mensch ein Glied ist, betrachtet werden; wenn einmal die
teleologische Beurteilung derselben durch die Naturzwecke, welche uns die
organisierten Wesen an die Hand geben, zu der Idee eines großen Systems der
Zwecke der Natur uns berechtigt hat. Wir können es als eine Gunst , die
die Natur für uns gehabt hat, betrachten, daß sie über das Nützliche noch Schönheit
und Reize so reichlich austeilete, und sie deshalb lieben, so wie ihrer
Unermeßlichkeit wegen, mit Achtung betrachten, und uns selbst in dieser
Betrachtung veredelt fühlen: gerade als ob die Natur ganz eigentlich in dieser
Absicht ihre herrliche Bühne aufgeschlagen und ausgeschmückt habe.“
Kant - Kritik der Urteilskraft - Kapitel 77
Das Angenehme, das Schöne, das Gute bezeichnen also drei verschiedene
Verhältnisse der Vorstellungen zum Gefühl der Lust und Unlust, in Beziehung auf
welches wir Gegenstände, oder Vorstellungsarten, voneinander unterscheiden. Auch
sind die jedem angemessenen Ausdrücke, womit man die Komplazenz in denselben
bezeichnet, nicht einerlei. Angenehm heißt jemandem das, was ihn vergnügt; schön,
was ihm bloß gefällt; gut, was geschätzt, gebilligt, d. i. worin von ihm ein objektiver
Wert gesetzt wird. Annehmlichkeit gilt auch für vernunftlose Tiere; Schönheit nur für
Menschen d. i. tierische, aber doch vernünftige Wesen, aber auch nicht bloß als
solche (z. B. Geister), sondern zugleich als tierische; das Gute aber für jedes
vernünftige Wesen überhaupt. Ein Satz, der nur in der Folge seine vollständige
Rechtfertigung und Erklärung bekommen kann. Man kann sagen: daß unter allen
diesen drei Arten des Wohlgefallens, das des Geschmacks am Schönen einzig und
allein ein uninteressiertes und freies Wohlgefallen sei; denn kein Interesse, weder
das der Sinne, noch das der Vernunft, zwingt den Beifall ab. Daher könnte man von
dem Wohlgefallen sagen: es beziehe sich in den drei genannten Fällen auf Neigung,
oder Gunst, oder Achtung. Denn Gunst ist das einzige freie Wohlgefallen. Ein
Gegenstand der Neigung, und einer, welcher durch ein Vernunftgesetz uns zum
Begehren auferlegt wird, lassen uns keine Freiheit, uns selbst irgend woraus einen
Gegenstand der Lust zu machen. Alles Interesse setzt Bedürfnis voraus, oder bringt
eines hervor; und, als Bestimmungsgrund des Beifalls, läßt es das Urteil über den
Gegenstand nicht mehr frei sein.
Was das Interesse der Neigung beim Angenehmen betrifft, so sagt jedermann:
Hunger ist der beste Koch, und Leuten von gesundem Appetit schmeckt alles, was
nur eßbar ist; mithin beweiset ein solches Wohlgefallen keine Wahl nach
Geschmack. Nur wenn das Bedürfnis befriedigt ist, kann man unterscheiden, wer
unter vielen Geschmack habe, oder nicht. Ebenso gibt es Sitten (Konduite) ohne
Tugend, Höflichkeit ohne Wohlwollen, Anständigkeit ohne Ehrbarkeit usw. Denn wo
das sittliche Gesetz spricht, da gibt es, objektiv, weiter keine freie Wahl in Ansehung
dessen, was zu tun sei; und Geschmack in seiner Aufführung (oder in Beurteilung
anderer ihrer) zeigen, ist etwas ganz anderes, als seine moralische Denkungsart
äußern: denn diese enthält ein Gebot und bringt ein Bedürfnis hervor, da hingegen
der sittliche Geschmack mit den Gegenständen des Wohlgefallens nur spielt, ohne
sich an einen zu hängen.
Kant - Kritik der Urteilskraft - Kapitel 13
6
3. Satz
Finden
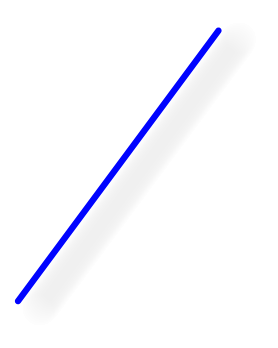
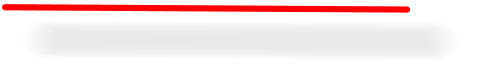
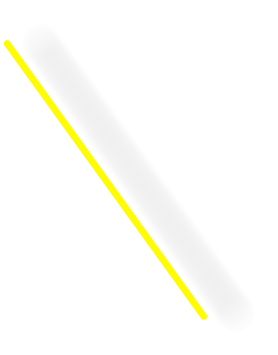
I
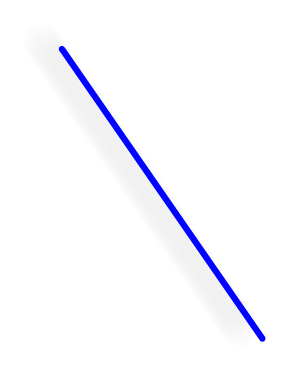
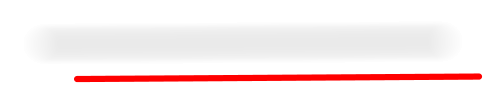
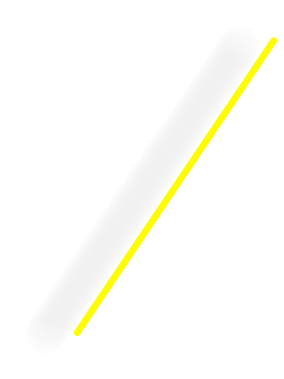
m
Du
erfahre
ich,
dass
mich
das
Sein
angeht,
dass
es
sich
an
mich
richtet,
dass
ich
verletzbar
und
beglückbar
bin.
Das
Du
schenkt
sich,
gibt
sich
hin,
berührt
und
durchdringt
damit
auch
meine
Seiten
des
Ichs.
Im
Du
werde
ich
angesprochen,
wird
die
Dreiheit
meines
Ichs
Sechsfach
durchbrochen.
Die
Beziehungen
von
Ich
und
Du
verdoppeln
die
Dreiheit
zur
sechseckigen
Gestalt.
Die
Farben,
die
Töne
des
Ichs
mischen
und
verbinden
sich,
das
Klangbild
des
Lebens
entsteht.
Die
Symphonie
erklingt
im
miteinander.
Violett,
in
dem
sich
Blau
und
Rot
durchdringen,
gibt
dem
Empfinden
ein
Wollen,
damit
daraus
die
Tat
entsteht,
wie
auch
aus
dem
Tun
das
Empfinden
immer
wieder
neue
Anstöße
erfährt.
Grün
blüht
auf
aus
dem
Blau
des
Empfindens
und
wird
zusammenmit
dem
Gelb
des
lichten
Denkens
zur
Hoffnung,
dass
sich
Sinn
zeigen
kann
in
immer
neuem
Werden.
Verschränken
sich
Tun
und
Lassen
mit
dem
in
erfüllter
Leere
sich
selbst
vergessenden
Denkens,
wird
Orange,
die
Symbolfarbe,
die
auszudrücken
vermag,
wie
eng
Körper
und
Geistaufeinander
angewiesen
sind.
Die
verdoppelte
Dreiheit,
sie
bindet
die
Seiten
des
Ichs
enger
aneinander
und
näher
zur
Mitte
hin.
In
ihrer
Farbigkeit
erscheint
die
Sehnsucht
nach
der
heilenden
Einheit
von
Körper,
Seele
und
Geist.
In
diesem
Miteinander
kann
das
Ich
den
Weg
finden,
der
den
Verlust
der
Einheit
für
Augenblicke
in
Lust
vergessen
macht.
So
wird
in
der
Vereinigung
von
Ich
und
Du
das
Werden
im
Sein
bezeugt,
und
in
der
Verschmelzung
von
Ich
und
Du
neues
Leben,
neues
Werden
gezeugt.
Im
anderen
Ich
begegne
ich
mir
selbst,
im
Du
erfahre
Ich
das
Andere,
wie
auch
das
mir
Gleiche.
Erst
in
dieser
unablässigen
Erfahrung
der
Begegnung
wird
der
Mensch
zur
Person
und
die
Menschen
zur Gattung.
Erst
im
Du
finde
ich
mich,
erhalte
ich
durch
den
Ruf
des
Du
meinen
Namen.
Finde
ich
mich
im
Du,
entsteht
eine
Gestalt,
die
mehr
ist
als
nur
die
Zuordnung
der
Elemente.
Vom
Du
her
wird
mir
der
Sinn
im
Dasein
eröffnet.
Im sechseckigen Stern blinkt das Licht des Ursprungs.
7
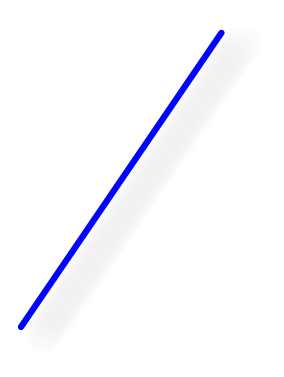
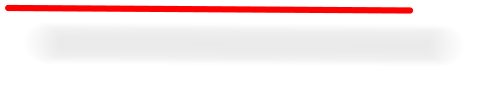
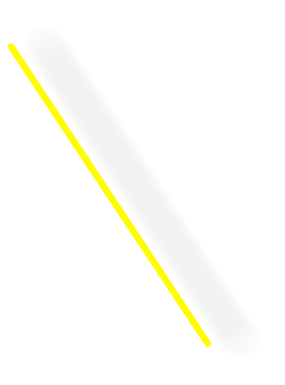
D
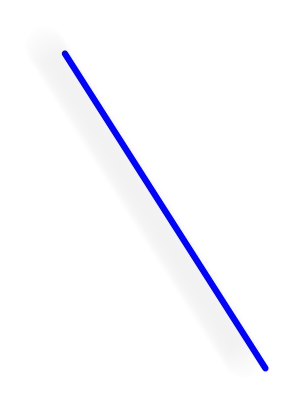
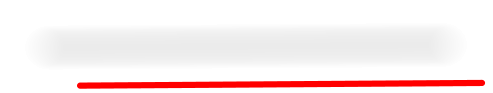
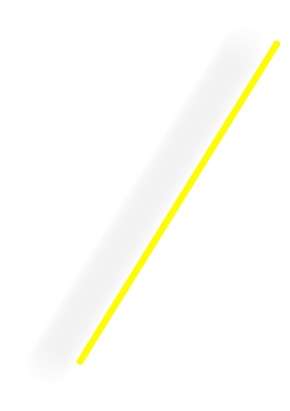
Vom Licht
zur
Antwort im Menschsein
1. Satz
Heilendes Licht
III. SYMPHONIE
ie
Mitte
ist
unverrückbar,
doch
wo
sie
zu
finden
ist,
kann
von
den
Seiten
des
Ichs
allein
nicht
erkannt
werden.
Gehe
ich
nur
von
einer
Seite
aus,
werde
ich in die Irre geleitet, gehe ich alleine, fehlen mir die Kräfte für den Weg.
Du
und
Ich,
Wir,
suchen
nach
dem
Empfinden,
das
uns
aus
der
Mitte
entgegenkommt,
dem
Handeln
in
Gelassenheit,
das
die
Bewegung
zur
Mitte
anstößt,
dem
Denken,
das
den
Weg
zur
Mitte
zeigt.
Wir
erfahren
die
Vielfarbigkeit
des
Daseins
und
ahnen,
dass
sich
bereits
im
gebrochenen
Licht
unseres
Daseins,
ein
strahlendes,
wärmendes,
heilendes
Licht
zeigen
kann.
Menschen
haben
aus
der
gesuchten
und
gefundenen
Mitte
ihrer
Dreiheit
heraus,
dieses
Licht
geoffenbart.
Sie
geben
uns
Maß.
Durch
sie
ist
Licht
ins
Dasein
gekommen.
In
ihnen
leuchtet
das
Licht.
Von
ihnen
strahlt
das
Licht
aus.
Mit
ihnen
werden
wir
in
das
Licht
hineingenommen,
das
die
Nacht
unseres
Todes
erhellt.
Brennender,
Erleuchteter,
Licht
vom
Lichte,
Lichtkünder.
Gottessohn
vor
und
nach
der
Zeit,
Menschensohn
in
der
Zeit,
Offenbarer im Geist durch die Zeiten hindurch!
Wenn
ein
Du
mich
anspricht,
mich
annimmt
wie
ich
zu
sein
vermag,
wird
es
heller,
ein
heilendes
Licht
kommt
mir
entgegen.
Ich
und
Du
finden
uns
dann
in
einer
Gestalt,
die
vom
Licht
aus
der
Mitte
erhellt
wird.
Die
Seiten
des
Ichs
drehen
sich
um
die
Achse
der
Mitte.
Außen
als
besinnungsloses,
rasendes
Drehen,
Innen
als
Schweben
in
gedehnter
Zeit,
im
Innersten
als
zeitlose
Ruhe, die alle Unruhe hält.
Gottsucher
sind
wir
aus
unserem
dreifachen
Menschsein
heraus
geworden;
aus
dem
Empfinden,
dass
wir
nicht
aus
uns
selbst
geworden
sind,
aus
dem
Handeln
im
Dasein,
das
uns
Freiheit
schenkt
und
Verantwortung
fordert,
aus
unserem
Denken,
das
immer
wieder
in
Grenzen
festhalten
will,
was
sich
erst im Loslassen entfalten kann.
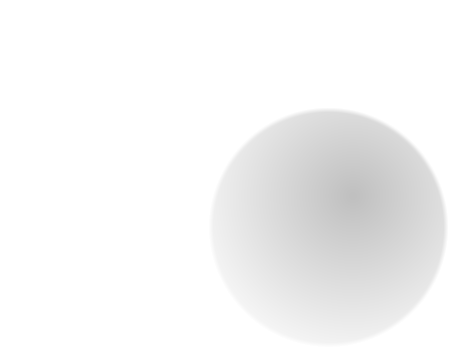
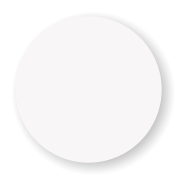


Die
Dreiheit
des
Ichs
zieht
das
Unsagbare
unablässig
zum
Sagbaren
herab,
entfaltet
damit
Gott
als
Einheit,
als
Vielheit,
als
Vater,
Sohn
und
Geist
in
unserer
Welt.
Das
Kostbare
wird
im
Gefäß
des
Sagbaren
gesammelt.
Ohne
die
Gefäße,
die
wir
uns
formen,
zerfließt
sein
Inhalt,
aber
ohne
es
immer
wieder
auch
neu
zu
füllen,
vertrocknet
das
Kostbare
bis
auch
das
Gefäß
erstarrt,
zerspringt.
Im
Wechsel
von
Nachfüllen
und
reifen
lassen,
wird
der
Glaube
lebendig
bleiben.
So
wird
jeder
Augenblick
zum
Experiment
eines
immer
neuen
Scheiterns
aber auch zur Hoffnung eines immer neuen Gelingens.
Wir
suchen
das
Rettende
im
wahren
Denken,
im
empfundenen
Schönen,
im
Tun
des
Guten
und
können
es
nur
finden
im
Zusammenklang
der
Seiten
des
Ichs,
im
Suchen
des
„Dazwischen“
der
Seiten,
im
stetigen
Wechsel
von
einer
Seite
zur
anderen.
Wir
können
die
Zwischenräume
für
die
Beziehungen,
die
im
Geheimnis
des
Seins
verborgen
sind
und
doch
unser
Dasein
umfangen,
öffnen
und
nennen
dies
Beten.
Damit
versuchen
wir
immer
wieder
auf
das
Innerste
im
Innen,
auf
das
Äußerste
im
Außen,
auf
das
Schweigen
und
Lachen
an
den Grenzen des Seins zu hören.

Die Herrlichkeit als die Totalität der Schönheit,
die Erhabenheit im begegnenden Schönen,
„rührt nur daher, daß die Kategorien von Rhythmus,
Polarität, Fügung des scheinbar Ungefügten,
Ungefügen sich für die Totalität nur noch ahnungsweise
anwenden lassen, wo sie im Teilstück (etwa in einer Symphonie)
überblickbar, überhörbar sind.“
Hans Urs von Balthasar - Herrlichkeit - Band III,I - S. 944
8
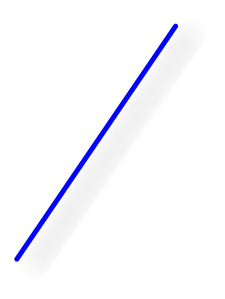
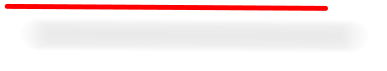
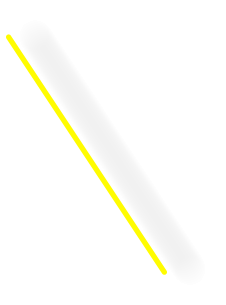
I
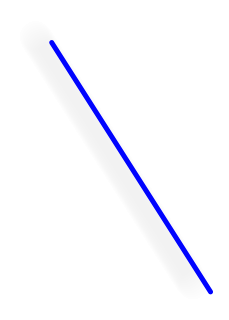
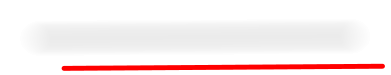
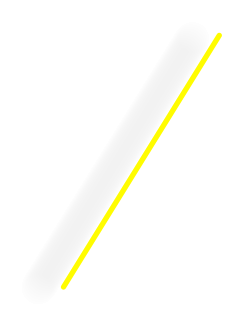
2.Satz
Entzweiung
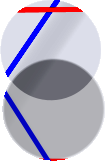
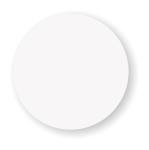
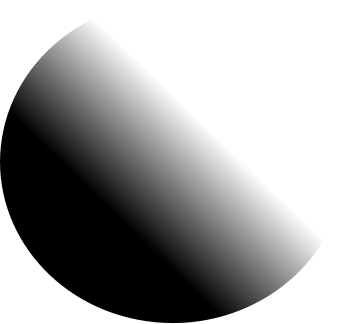
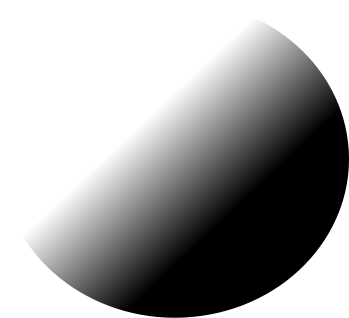
n
das
heilende
Licht
der
pulsierenden
Hoffnung
schleicht
sich
das
Schwarz
des
Zweifels.
Liebe
-
Gott,
zwei
missbrauchte
Begriffe,
verschmutzt
im
Dunkel
der
Zeiten.
Schwarz
verdreckt
leuchtendes
Rot.
Tod
ist
allem
Tun,
aber
auch
allem
untätigen
Geschehenlassen
eingefleischt.
Schwarz
zerstört
leuchtendes
Gelb.
Gedanken
werden
zerfressen
von
Hass
und
Neid.
Schwarz
verdunkelt
leuchtendes
Blau.
Hasserfülltes
Wollen
schleicht
aus
dem
Gefängnis
der
Empfindungen.
Das
verlorene
Geheimnis
wird
durch
monströse Prothesen ersetzt, es wird vergewaltigt und verraten.
Ist
der
gute,
der
rettende
Gott
selber
noch
zu
retten?
Regiert
uns
Liebe
oder
Hass?
Ist
das
Böse,
das
Grauen,
der
Wahn-Sinn
nur
dem
Menschen
anzulasten?
Oder
kommen
wir
sogar
aus
den
Händen
böser
Mächte,
verflucht
uns
Gott?
Bilden
wir
Gott
nach,
nach
unserem
beschränkten
Sein?
Wird
er
durch
uns
zu
einem
unheilvollen,
übergroßen
Du,
zu
unserem
übermächtigen
oder
machtlosen
Spiegelbild,
Angst
schaffend
durch
seine
strafende Macht, verlacht und verspottet in seiner sinnlosen Ohnmacht.
Es
ist
dieser
von
uns
gemachter
Gott,
der
Gott
unserer
Kurzsichtigkeit,
der
zu
allem
missbraucht
werden
kann.
Dieser
von
uns
Geschaffene
lässt
alles
zu,
was
wir
in
unserer
Beschränktheit
wollen.
Dieser
Gott
wird
zu
allem
benutzt,
zur
Vergottung
des
Nutzens
und
der
Lust.
Dieser
Gott,
aus
Angst
und
Ignoranz
von
uns
geschaffen,
lähmt
uns,
er
tötet
uns.
Die
Dualitäten,
die
Trennungen sind sein Ursprung.
Ist
Gott
also
tot?
Und
wer
ist
schuld
an
seinem
Tod?
Wir,
die
wir
aus
unserer
Unmündigkeit
nur
nach
uns
selber
rufen,
nur
uns
selber
träumen,
nur
uns
selber
schaffen?
Wir,
die
wir
in
unserer
Beschränktheit
einen
winzigen
Teil
für
das
Ganze
und
Wichtigste
halten?
Wir,
die
wir
die
Suche
abbrechen,
bevor
das
Licht
die
Nacht
erhellen
kann?
Wer
tötet?
Ist
es
unser
in Freiheit verirrter Wahn?
Aber
unser
Schreien,
nach
dem
Warum
des
unschuldigen
Leidens
im
Atem
der
schuldbeladenen
Zeit,
es
verhallt
ungehört
im
Schwarz
des
Nichts.
Du,
Bild
des
offenen
Geheimnisses,
wir
klagen
an:
Wo
warst
Du,
Gott
allmächtiger,
Du
Gott
der
Liebe,
an
all
den
Orten
des
Grauens,
der
Vernichtung, in . . . Auschwitz . . . in . . . in . . . in . . .
Wolltest,
willst
Du
nicht
eingreifen,
oder
kannst
du
es
nicht?
Sind
wir
ohne
Hoffnung, von dir losgelöst, gekettet an uns selber?
Wir
fragen
dich:
Du
bist
doch
in
allem,
Du
wirst
doch
auch
durch
unsere
Taten
und
Untaten,
Du
bist
doch
im
Leid
gegenwärtig,
DeinWerden
geschieht
doch
auch
durch,
mit
und
in
dieses
unbeschreibliche
Leid?
Es
ist
doch
dein
Werden,
dem
dies
alles
geschieht?
Wie
kannst
Du
dies
vor
deiner
Liebe
zu
deiner
Schöpfung
verantworten?
Wir
können
wir
glauben,
wie
wir
auch
in
unseren
Leiden
mit
Dir
zu
einer
Gestalt
werden?
Bleiben
die
Antworten auf diese Fragen im offenen Geheimnis für immer verschlossen?
Die Folgen des Getanen kann ich nicht abwälzen,
sondern nur gestalten und verwandeln
"Aber
ich
bleibe
auf
dem
Wege
und
bin
nicht
im
Besitz
[der
Wahrhaftigkeit].
Statt
der
Identität
meiner
mit
mir
selbst
kann
eine
Trennung
von
mir
einsetzen.
Was
ich
in
einer
Tat,
in
einer
Lebenspraxis
war,
das
will
ich
nicht
sein.
Zwar
muß
ich
sie
übernehmen,
aber
ich
vollziehe
die
Trennung
in
einer
Umkehr
meiner
selbst.
Geschieht
das
im
Ernst,
dann
muß
ich
doch
leben
mit
etwas,
das
ich
nie
mehr
loswerden
kann.
Ich
bin
ein
Anderer
als
zu
Anfang.
Die
Umkehr
gründet
ein
Leben,
das
übernehmen
muß,
was
mir
fremd
geworden
ist
und
doch
zu
mir
gehört.
Die
Umkehr
ist
wahr
mit
dem
neuen
Blick,
der
neuen
Urteilskraft,
durch
die
geschieht,
was
die
Umkehr
bezeugt.
Das
Gewesene
wird
trotz
Wiedergeburt
übernommen,
nicht
abgestoßen,
als
ob
es
nicht
gewesen
sei.
Ich
bin
nicht
befreit
in
einem
absoluten
Sinn
(solche
Befreiung
ist
weder
durch
eigenen
Entschluß
noch
durch
Gnade
möglich).
Vielmehr
trage
ich
die
Folgen
des
Getanen
und
Gelebten,
die
ich
nicht
abwälzen,
sondern
nur
sehen,
mit
meinen
Möglichkeiten gestalten und verwandeln kann."
Karl Jaspers in "Der philosophische Glaube
angesichts der Offenbarung", S. 173
9
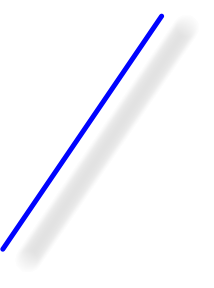
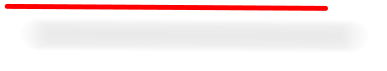
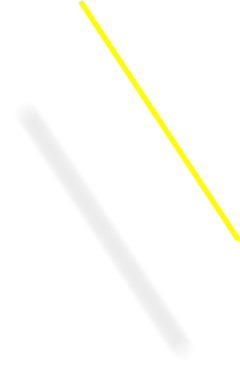
G
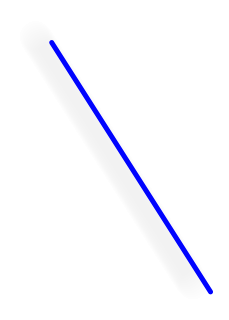
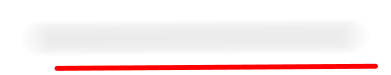
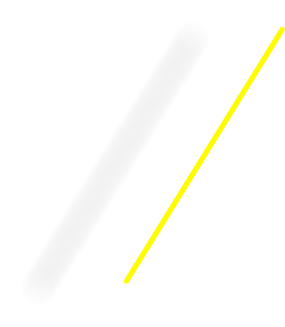
3.Satz
Menschheit
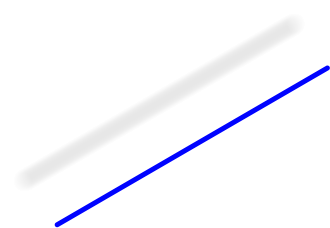

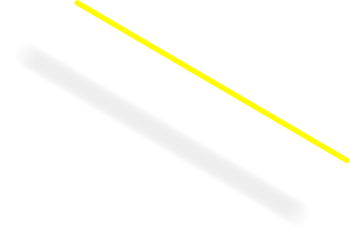
eschenktes
und
gefundenes
Wissen
um
das
werdende
Sein,
sagt
mir
im
Gewissen,
das
was
sein
soll.
Sich
vom
Geheimnis,
das
sich
so
vielfältig
zu
uns
öffnet,
ansprechen
lassen,
es
anzunehmen,
es
zu
erkunden,
gibt
mir
den
Halt,
auch
den
Nächsten,
wie
auch
mein
eigenes
Ich
mit
all
seinen
Seiten
anzunehmen.
Unter
die
Herrschaft
von
Zeit
und
Raum
gestellt,
im
Freiheitsraum
der
Möglichkeiten,
suchen
wir
beständig
nach
Antworten
auf
das
Seinsollende.
Finden
können
wir
es
dann,
wenn
wir
uns
auf
die
Mitte
zubewegen und uns nicht in der Hybris der Maßlosigkeit verlieren?
Es
ist
ein
mühsamer,
unaufhörlicher
Dialog,
der
vom
dreifaltigen
Licht
des
Einen
im
dreifachen
Ichsein
jedes
Menschen
entzündet
wird.
Ein
unendlicher
Dialog,
der
seinen
Sinn
erst
entfalten
kann,
wenn
er
im
Aufleuchten wieder auf die Einheit zurückstrahlt.
Die
Fülle
aller
Farben
wird
in
der
Menschheit
in
allen
Mischungen
entfaltet,
mit
allen
Aufhellungen
im
Weiß,
mit
allen
Schattierungen
im
Schwarz.
Die
Menschheit
zeigt
sich
in
einer
unerschöpflichen
Vielfalt,
einer
Vielfalt,
die
im
Einzelnen
uns
gefangen
nimmt
,
uns
aber
in
der
Zusammenschau
überfordert.
Daraus
wird
ein
stets
Wissen
und
Nichtwissen
um
das
was
ist,
ein
Empfinden
und
Nichtempfinden
zu
dem
was
ich
bin,
ein
Tun
und
Lassen
für
das
,was
sein
soll.
Es
ist
das
Richtig
und
Falsch,
das
Schön
und
Häßlich,
das
Gut
und
Bös.
Es
ist
in
allen
Wissenschaften,
allen
Künsten
und
allen
Politiken zu finden.
Wir
suchen,
begrenzt
durch
die
Bindungen
im
Dasein,
nach
den
Möglichkeiten,
die
Sinn
geben
können,
für
das
Ich,
das
Ich
mit
dem
Du,
für
das
Wir,
Sinn
für
das
was
war,
Sinn
für
das
was
sein
soll.
Aus
unseren
engen
Grenzen
kriecht
die
Angst
den
Sinn
zu
verfehlen,
die
verzweifelt
Erkenntnis
des
Ungenügens.
Aber
gerade
diese
Begrenzungen
und
unsere
Ängste
vor
dem
Versagen,
die
Urangst
vor
dem
Tod,
stoßen
Erkenntnisse,
Änderungen,
Neuerungen
immer
wieder
an.
Gerade
im
Mitempfinden
der
Ängste
des
Anderen,
der
Anderen,
zeigen
sich
Wege
unser
Ich
zu
entgrenzen
,
um
dann
gemeinsam Sinnwege gehen zu können.
Die
Neun
ist
die
Symbolzahl
für
das
Suchen
der
Antworten
im
Alltag,
Antworten,
die
im
Hier
und
Jetzt
gegeben
werden
sollten,
um
im
Blick
auf
das
Gewordene
und
Kommende,
in
der
Hoffnung
einer
werdenden
Gestalt
Fülle
zu
verleihen.
Die
Antworten
werden
gesucht
im
Licht
der
Vernunft,
das
die
Seiten
des
Ichs
aneinander
bindet
und
im
Gedächtnis
des
Seins
bewahrt.
In
diesem
Miteinander
finden
die
Dreiecke
die
Gestalten
von
Pyramiden oder sich vielfach durchdringender Dreiecke.
Es
werden
Zeichen
zu
Bildern,
Töne
zu
Symphonien,
es
werden
Regeln
zu
Ordnungen,
Gedanken
zu
Systemen,
und
in
allem
wird
unser
Dasein
und
mit
ihm
unser
Sein
gestaltet.
Aber
es
bleibt
die
Frage
offen,
wo
ist
das
Maß
zu
finden, das Maß für das was sein soll ?
Die Klugheit, als erste unter den übrigen gleichrangigen
Tugenden „gebiert alle sittliche Tugend überhaupt.“
Die Verwirklichung des Guten setzt das Wissen
um die Wirklichkeit voraus. Das Gute ist das
Wirklichkeitsgemäße. „Wissen“ darf aber nicht verengt
werden zu szientistischem Erfahrungswissen.
In der Klugheit wird die sachliche Erkenntnis der Wirklichkeit
maßgebend für das Wollen und Tun.
Der Moralismus sagt: das Gute ist das Gesollte, weil es
gesollt ist.
Die Lehre von der Klugheit sagt: das Gute ist das
Wirklichkeitsgemäße; es ist gesollt, weil es der Wirklichkeit
entspricht.
Weise ist der Mensch, wenn ihm alle Dinge so schmecken,
wie sie wirklich sind. Der Mensch, der nur sich selber schmeckt,
weil er nur auf sich selber hinblickt, hat die Möglichkeit der
Gerechtigkeit und auch die seelische Gesundheit verloren.
Wissen und Ge-Wissen stehen
in einem engen Zusammenhang.
Josef Pieper - Über das christliche Menschenbild - S. 23-29
Was
wir
denken
wird
nicht
verloren
sein,
wenn
es
in
der
Mitte
gehalten
wird.
Was
wir
tun
und
lassen
wird
sein,
wenn
es
zur
Mitte
führt.
Was
wir
empfinden
wird
weiterwirken,
wenn
es
von
der
Mitte
gespeist
wird.
Die
Wege
zur
Mitte
werden
für
jeden
von
uns
andere
sein,
schon
deshalb,
da
bereits
der
Beginn
des
Suchens,
der
Beginn
des
Weges,
für
jeden
woanders
liegt.
Aber
der
Sog
zur
Mitte
ist
für
jeden
von
uns
der
Gleiche,
da
die
entfaltete
Gestalt
nur
eine
Mitte
kennt.
Deshalb
habe
Ehrfurcht
vor
dem
Leben
in
seiner
ganzen
Fülle
und
achte
die
unterschiedlichen
Wege,
die
bisher
in
der
Menschheit
gegangen
worden
sind.
Denn
welche
Schuld
liegt
im
Zerstören
von
dem,
was
die
Fülle
des
Seins
noch
zu weiten vermag.
Erfahre
dich
als
ein
Gewordener,
der
für
sein
so
sein,
immer
wieder
nach
Gründen
zu
seiner
Rechtfertigung
sucht.
Denn
welche
Schuld
liegt
in
der
Unwahrhaftigkeit, die die Fülle des Seins verengt.
Besinne
dich,
daß
in
dein
Urteilen
und
Entscheiden,
immer
auch
deine
Ängste
und
Hoffnungen
eingehen.
Denn
welche
Schuld
liegt
darin,
die
Wege
der
Anderen mit Vorurteilen zuzuschütten.
Bedenke,
daß
jedes
Verletzen
und
verletzt
werden
den
Weg
verdunkelt,
daß
jede
erfahrene
und
geschenkte
Zuneigung
aber
Wegzeichen
geben.
Denn
welche Schuld liegt darin, Andere in finsteren Nacht auf den Weg zu schicken.
Besinne
dich
auf
das,
was
all
deine
Seiten
wirklich
bedürfen,
um
sich
gegenseitig
befruchten
zu
können.
Erkenne,
daß
der
abgewogene
Verzicht
bei
einer Seite deines Ichs, den anderen Seiten an Fülle zuwachsen kann.
Setze
dich
dafür
ein,
den
Schwächeren
Möglichkeiten
zu
eröffnen,
um
ihre
Ängste
mit
Hoffnungen
zu
vertreiben.
Denn
welche
Schuld
liegt
darin,
daß
auch durch dich, Möglichkeiten des Seins zerstört werden.
Beziehe
die
Möglichkeiten
des
Zukünftigen
in
dein
Handeln
ein.
Wäge
die
Folgen
ab
und
verzichte
im
Zweifel.
Denn
welche
Schuld
liegt
im
Tun,
daß
die
Folgen nicht zu bändigen vermag.
Bin
bereit
zu
widerstehen,
wenn
du
in
wissender
und
gewissenhafter
Prüfung
überzeugt
bist,
daß
du
in
Ordnungen
eingebunden
wirst,
die
dem
Dasein
die
Fülle
berauben.
Spüre,
deine
Verantwortung
für
die
Freiheit
des
Anderen.
Denn
welche
Schuld
liegt
darin,
geschehen
zu
lassen,
daß
in
der
Unterdrückung, das Werden des Seins geknechtet wird.
Erkenne,
dass
alles
im
Teil
Richtige,
im
Ganzen
doch
die
Richtung
verfehlen
kann.
Wisse
um
die
Fülle
von
Wahrheiten
in
jedem
Du,
doch
vergiss
nicht,
diese im Dialog an das Geheimnis der Mitte zu binden.
Sei
im
offenen
Geheimnis
und
sei
es
mit
den
Anderen
und
dann
erst
sei
Jude,
Buddhist,
Christ,
Muslim
.
.
.
Löse
dich
von
deinen
Bildern,
die
das
Geheimnis
festhalten
möchten.
Denn
welche
Schuld
liegt
darin,
wenn
aus
den
Bildern
Waffen geschmiedet werden.
Suche
das
rechte
Reden
und
Schweigen
vor
dem
Geheimnis,
das
uns
immer
mehr
sagt,
als
wir
es
für
möglich
halten.
Suche
in
der
dir
geschenkten
Freiheit
nach
Antworten
in
den
Möglichkeitsräumen,
nach
dem,
das
uns
in
den
Verschiedenheiten
die
Einheit
öffnet.
Suche
nach
den
Beziehungen
und
Bewegungen
im
Sein,
die
wir,
in
der
umfassenden
Gestalt
des
offenen
Geheimnisses, als die große Liebe erfahren dürfen.
In
all
diesem
Sollen
kreuzt
sich
das
vergangene
Werden
mit
der
entgegenkommenden
Fülle.
So
ändert
sich
In
jedem
Augenblick
das
Sollen,
da
sich
auch
das
Sein
stets
verändert,
aber
es
bleibt
stets
auch
gleich
in
seiner
Orientierung
am
immer
Gleichen
des
uns
Entgegen-kommenden.
Unser
Sein
ist
Dazwischen-Sein,
nie
im
Ganzen
verlassen,
nie
im
Ganzen
daheim.
Erst
wenn
die
Zeit
beginnt
das
Sein
zu
verlassen,
kann
sich
der
Sinn
als
Ganzes
zeigen, die Fülle seiner ganzen Gestalt.
Bin
bereit
zu
widerstehen,
wenn
du
in
wissender
und
gewissenhafter
Prüfung
überzeugt
bist,
daß
du
in
Ordnungen
eingebunden
wirst,
die
dem
Dasein
die
Fülle
berauben.
Spüre,
deine
Verantwortung
für
die
Freiheit
des
Anderen.
Denn
welche
Schuld
liegt
darin,
geschehen
zu
lassen,
daß
in
der
Unterdrückung, das Werden des Seins geknechtet wird.
Erkenne,
dass
alles
im
Teil
Richtige,
im
Ganzen
doch
die
Richtung
verfehlen
kann.
Wisse
um
die
Fülle
von
Wahrheiten
in
jedem
Du,
doch
vergiss
nicht,
diese
im Dialog an das Geheimnis der Mitte zu binden.
Sei
im
offenen
Geheimnis
und
sei
es
mit
den
Anderen
und
dann
erst
sei
Jude,
Buddhist,
Christ,
Muslim
.
.
.
Löse
dich
von
deinen
Bildern,
die
das
Geheimnis
festhalten
möchten.
Denn
welche
Schuld
liegt
darin,
wenn
aus
den
Bildern
Waffen geschmiedet werden.
Suche
das
rechte
Reden
und
Schweigen
vor
dem
Geheimnis,
das
uns
immer
mehr
sagt,
als
wir
es
für
möglich
halten.
Suche
in
der
dir
geschenkten
Freiheit
nach
Antworten
in
den
Möglichkeitsräumen,
nach
dem,
das
uns
in
den
Verschiedenheiten
die
Einheit
öffnet.
Suche
nach
den
Beziehungen
und
Bewegungen
im
Sein,
die
wir,
in
der
umfassenden
Gestalt
des
offenen
Geheimnisses, als die große Liebe erfahren dürfen.
In
all
diesem
Sollen
kreuzt
sich
das
vergangene
Werden
mit
der
entgegenkommenden
Fülle.
So
ändert
sich
In
jedem
Augenblick
das
Sollen,
da
sich
auch
das
Sein
stets
verändert,
aber
es
bleibt
stets
auch
gleich
in
seiner
Orientierung
am
immer
Gleichen
des
uns
Entgegen-kommenden.
Unser
Sein
ist
Dazwischen-Sein,
nie
im
Ganzen
verlassen,
nie
im
Ganzen
daheim.
Erst
wenn
die
Zeit
beginnt
das
Sein
zu
verlassen,
kann
sich
der
Sinn
als
Ganzes
zeigen,
die
Fülle seiner ganzen Gestalt.
10
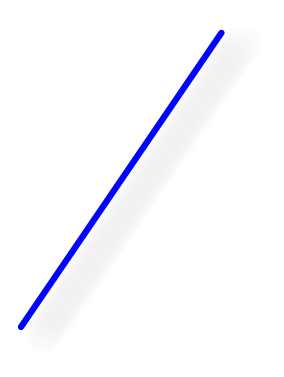
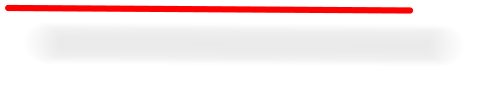
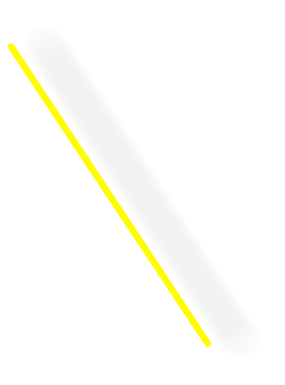
D
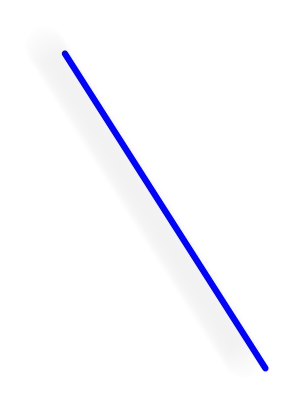
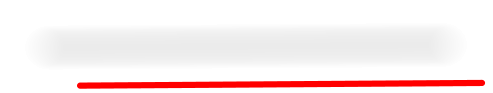
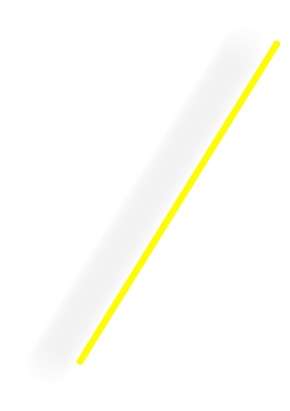
Von der Erlösung
zur
Fülle des Seins
1. Satz
Erlösung
IV. SYMPHONIE
as
Sein
bleibt
im
Werden
immer
offen,
ereignet
sich
immer
neu,
wächst
auch
in
unser
Ich
hinein,
und
findet
darin
die
Laute
und
Töne
für
seine
Symphonie.
Aus
dem
Gefundenen
meinen
wir
das
Mögliche
zu
wissen,
aber
die
Möglichkeiten,
die
der
Gestalt
die
ganze
Fülle
erst
verleihen,
sind für uns unvorhersehbar, nur als ein Hauch ahnbar.
So bleibt aber immer die Hoffnung auf Lösung unseres Seins, allen Seins,
aus
seinen
Dualitäten
in
ein
Anderes
hinein,
ein
Öffnen
zum
Geheimnis
hin,
ein
Werden
des
Anderen,
auch
durch
uns.
Alles
Mögliche
wird
im
Werden
der
Gestalt
das
Wirkliche.
Wird
die
Eins
(die
Einheit),
mit
der
Zwei
(der
Dualität),
der
Drei
(dem
Ich)
und
der
Vier
(dem
Ich,
das
die
Mitte sucht) zusammen gezählt, ergibt sich die Symbolzahl Zehn.
Im
Tod
verliert
unsere
Dreiheit
des
Ichs
den
Bezug
zum
Sein
in
Raum
und
Zeit,
aber
das
im
Seinsbezug
Gewordene
und
Gewonnene
bleibt
solange
in
den
Möglichkeiten
des
Daseins
gebunden,
bis
es
endgültig
im
Geheimnis ankommt und mit ihm die letzte Wirklichkeit bildet.
Alle
Versuche,
das
Trennende
bereits
im
Dasein
zu
binden
und
zu
umgreifen,
geben
uns,
trotz
aller
Zweifel,
einen
ersten
Halt,
geben
uns
Beständigkeit
und
Bestätigung
im
Werden.
Das
Ich
kann
sich
mit
dem
Du
loslösen
aus
dem
betäubenden
Drehen
in
der
Zeit,
um
der
Klarheit
der
Mitte
entgegen
zu
fallen.
Hier
geschieht
bereits
ein
Ent-werden
in
weitendes Sein.
Und
sind
wir
auch
nur
eine
winzige
Episode,
so
wäre
doch
alles
Sein
ein
Anderes
ohne
die
geschenkte
Freiheit,
die
wir
selbst
verwirklichen.
Unser
aller
Wollen,
Sollen,
Tun
und
Lassen
ist
im
Sein
verankert,
nimmt
Anteil an der Entfaltung zur Fülle, gestaltet mit.

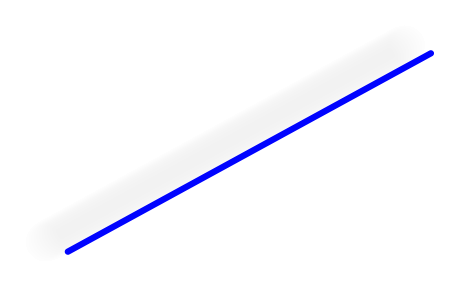
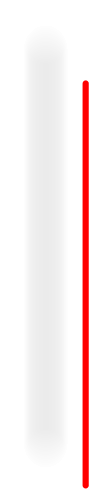
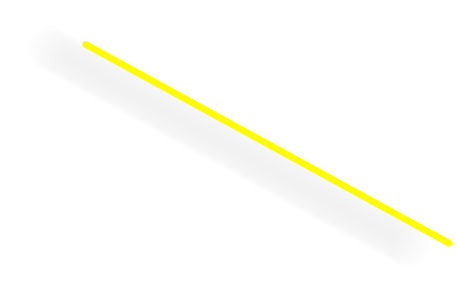
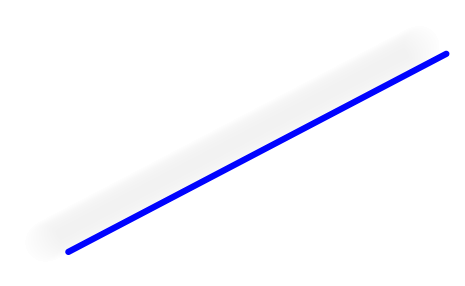
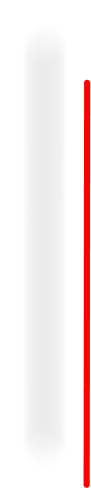
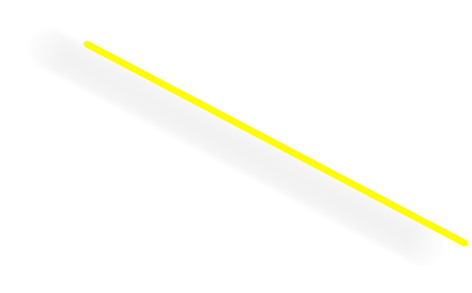
Im
Tod
lösen
sich
die
Seiten
des
Ichs,
um
sich
im
Glanz
von
Silber
und
Gold,
in
einer
Zusammenschau
einzulösen.
Dies
wird
mir
geschehen,
wenn
dafür
in
meinem
Hoffen,
Wollen
und
Tun
Verbindungen
geknüpft
wurden,
die
die
Kraft
enthielten
dem
Sein
etwas
Bleibendes
zu
schenken.
Aber
erst,
wenn
Raum
und
Zeit
das
Sein
verlassen,
erfährt
unsere
Freiheit
ihr
letztes
Wozu,
erst
dann
vereinigen
sich
Liebe
und
Gerechtigkeit und bringen sich der Wahrheit dar.
Aber
allein
aus
uns
selbst
ist
letztendlich
keine
Lösung
aus
dem
Sein
möglich.
Ich,
wir
und
alles
bedarf
der
Loslösung
in
ein
Anderes
durch
Erlösung.
Unser
Dasein
gewinnt
eine
letzte
Fülle,
missbrauchte
Worte
gewinnen
ihren
vollen
Klang.
Hier
hebt
der
Jubel
an.
Die
Farben
glänzen
auf
zum
Entschwinden
in
der
Zeit,
die
kalten
Schatten
lösen
sich
im
Glanz
des
heilenden
Lichts.
Diese
Lösung
aus
dem
Sein
in
das
Geheimnis
hinein,
sie
geschieht
überall
im
ganzen
Universum,
in
ungeahnten
Formen, in unsagbaren Weisen, in unausdenkbaren Wesen.
Im
Zusammenklang
erfüllt
sich
in
der
Erlösung
das
in
den
Stunden
und
Orten des Daseins Gewirkte in einer unsagbaren Gestalt.
11
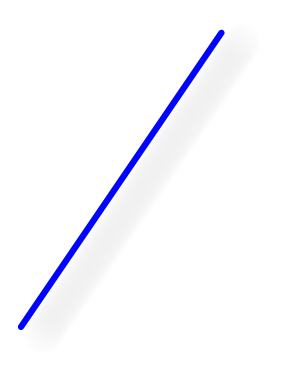
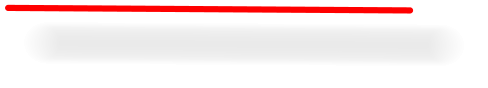
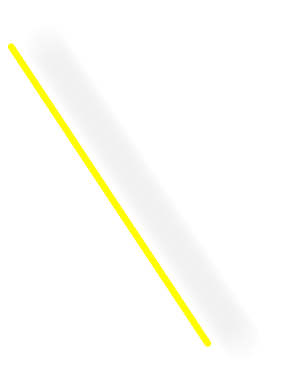
I
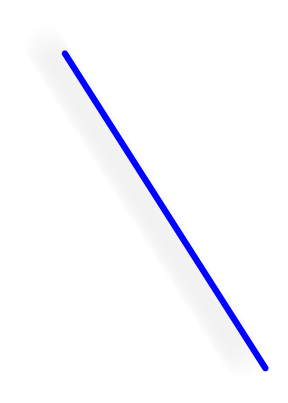
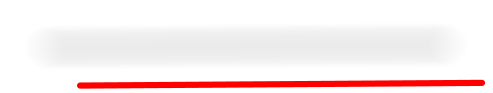
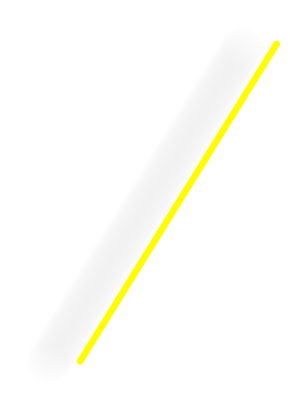
2. Satz
Gericht
m
Atem
der
erschöpften
Zeit
wird
das
Sein
zur
Fülle
des
Einen
entgrenzt
oder
zum
Nichts
des
Vielen
verengt.
Ein
letztes
Werden
hin
zur
Erlösung
oder
zur
Verdammnis.
Ein
letztes
Wort
an
das
geschenkte
Sein,
dem
das
Sein
nur
wortlos
mit
letzter
Hingabe
zu
antworten
vermag.
Das
Wort
des
Anfangs
wird
im
Ende
erfüllt
im
Licht
der
Gestalt
des
einen
Ganzen.
Das
Geheimnis
des
Lebens,
des
Weges
und
der
Wahrheit
wird geöffnet.
Im
Gericht
erfahren
wir,
das
in
der
geschenkten
Freiheit
Verlorene,
das
im
geforderten
Sollen
Zerstörte.
Wir
schauen
das
von
uns
Zurückgeschenkte,
Geglückte,vom
Geheimnis
angenommene.
Alles
Erfahrene,
Gedachte,
Getane
holt
uns
ein.
Wer
scheidet,
wer
richtet?
Werden
wir
gerichtet?
Richten
wir
uns
selbst?
Richten
wir
uns
selbs
tin
das
Geheimnis
hinein,
das
bis
Zuletzt
grenzenlos
offen
ist
für
alles
Gewordene?
Verlieren
wir
uns
selbst,
mit
dem,
was
durch
uns
im
Werden
verloren
wurde?
Werden
wir
zusammen
mit
dem
Raum
und
der
Zeit
dann
endgültig
ins
Nichts
des
ewigen
Dunkels
geworfen
oder
erhellt
in
einem
neuen
Werden
und
in
diesem
Werden
dem
zeitlos
Gleichen gleich?
Aller
Schatten
wird
zum
Nichts,wir
erblinden,
doch
alles
Licht
wird
im
reinen,
ewigen
Licht
der
vollendeten
Einheit
aufgefangen,
wir
schauen.
Das
Sein
zwischen
„Noch-Nicht“
und
„Nicht-Mehr“
wird
zum
Augenblick
der Ewigkeit.
Der
Name,
mit
dem
wir
gerufen
wurden,
wird
bewahrt
im
Innersten
des
offenen
Geheimnisses;
dies
bleibt
uns
im
Sein
als
letztes
Hoffen,
als
letzte
Gnade,
als
letzte
Gabe.
Hier
stockt
der
Atem
der
Zeit.
Hier
ist
Geber und Gabe eins, Tiefe und Höhe eins, Innen und Außen eins.
Und
doch
sind
alle
Dualitäten
nicht
verloren
sondern
eingewoben
in
das
geöffnete
Geheimnis.
Die
Bewegung
aus
dem
Ursprung
wird
durch
den
Endsprung
in
die
Zeit-
und
Raumlosigkeit
vollendet.
Das
All
wird
entbunden
und
in
das
Geheimnis
des
gewandelten
Ewigen
eingebunden
durch
die
Gnade
der
Trinität.
Es
ist
ein
Erhellen
und
Einklingen
in
die
Wahrheit
des
immerwährenden
Erinnerns,
aber
auch
ein
Ausklingen
und Erblinden ins Nichts des immerwährenden Vergessens.
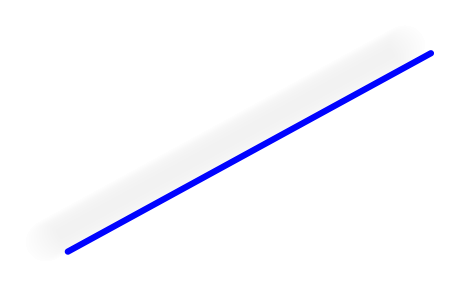
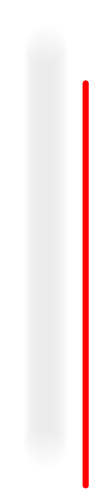
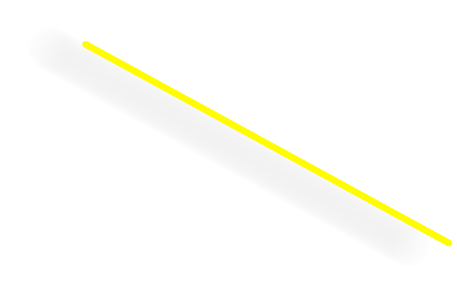
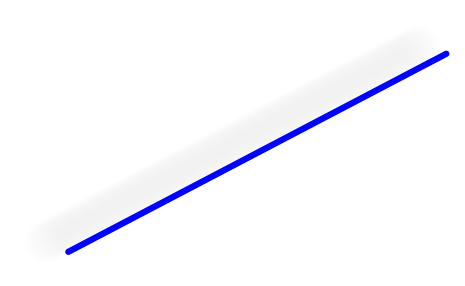
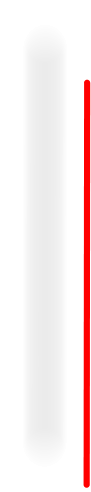
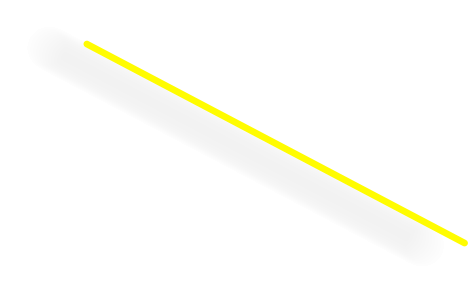
12
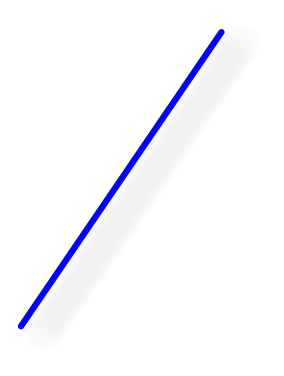
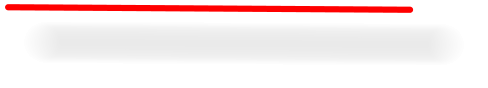
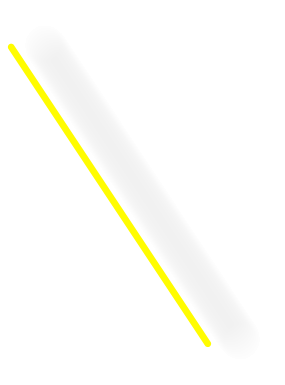
K
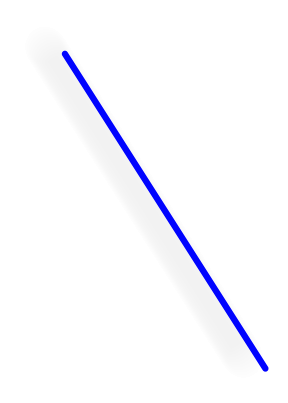
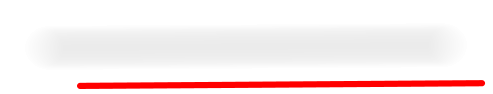
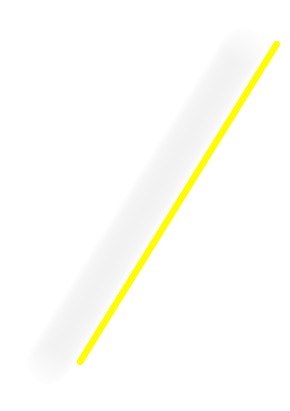
3. Satz
Fülle des Seins
ein
„Entweder
-
Oder“
sondern
ein
„Sowohl
als
auch“
ist
das
Maß
der
Fülle.
Sowohl
Materie
als
auch
Geist
ist
in
allem
Sein.
Sie
fallen
zusammen
im
reinen,
ewigen
Licht
und
verschwinden
doch
nicht
im
Nichts,
lösen
sich
nicht
auf
in
der
Unendlichkeit,
sondern
werden
ein
Anderes.
Der
Stern
bildet
aus
unendlich
vielen
Elementen,
Innen
und
Außen,
sowohl
den
Kreis
des
Anfangs
als
auch
des
Endes,
sowohl
die
unentfaltete
als
auch
die
entfaltete
Einheit.
Die
Zwölf
mit
sich
selbst
vervielfältigt
wird
damit
zum
Symbol
der
Unendlichkeit,
zum
Kristall,
der
mit
seinen
unendlich
vielen
Ecken
funkelt
im
reinen
Licht
spiegelt.
In
ihm
spiegeln
sich
die
unendlichen
Möglichkeiten
wider
und
unzählige Punkte lassen Raum und Zeit verschwinden.
Die
Gestalten,
sie
brauchen
keine
Orientierung
mehr,
denn
sie
ist
ihnen
in
der
einen
Gestalt
der
Fülle
gegeben.
Dann
kann
keine
Bewegung,
die
aus
den
Dualitäten
geboren
wurde,
dem
schattenlosen
Geheimnis
ein
noch
so
Winziges
hinzufügen.
Die
Zeit
wird
regiert
vom
Tod.
Doch
schon
im
Dasein
kreuzen
sich
Tod
und
Leben,
Zeit
und
Ewigkeit,
bis
sich
alles
Kreuzen,
in
der
Gestalt
nach
und
vor
der
Zeit,
in
der Einheit des Kreises erschöpft und vollendet.
Wenn
sich
das
Dazwischen-sein
weitet,
sich
die
Leere
zwischen
den
Formen
füllt,
werden
die
Bilder
des
Seins
entschlüsselt
und
alle
Töne
und
Laute
in
der
Stille
hinein
genommen.
Frage
und
Antwort
treffen
und
versöhnen
sich
im
Schweigen.
Der
Atem
findet
seine
Ruhe,
wird
mit
Allem
in
der
und
durch
die
Mitte
gebunden,
so
daß
sich
in
der
Fülle gleicht, was sich im Weg unterschied.
Was
allein
kann
dem
Gegebenen
das
Sein
wieder
nehmen,
was
allein
die
Möglichkeiten
aufheben
in
eine
letzte
Notwendigkeit
hinein,
was
allein
den
Raum
und
Zeit
in
ein
Anderes
wandeln,
was
allein
das
Ende
mit
dem
Anfang
verbinden,
als
ein
unsagbare
Geheimnis,
das
uns
das
Sein
und uns im Sein diese Hoffnung gab?
Ich
bin,
der
ich
bin,
ich
bin,
der
ich
sein
werde,
und
ich
werde
der
sein,
der
ich
im
Sein
werde.
Sind
diese
Worte
auch
dem
Dasein
entsprungen,
sind
sie
uns
doch
zugerufen
von
der
Grenze
des
unausdenklichen
Geheimnisses
her.
Dort
wird
dieses
Verlöschen
im
erfüllten
Schweigen
der Allfalt zur Geburt des Lichts im Licht des Lichts.
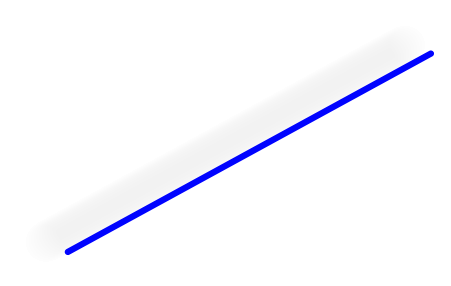
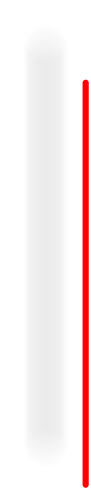
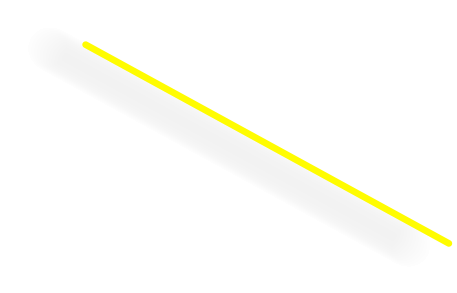
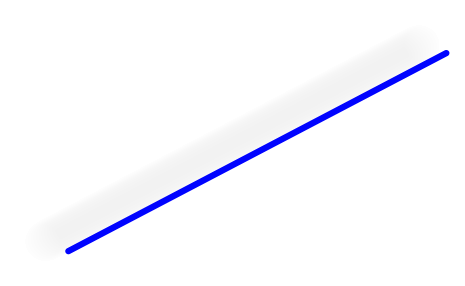
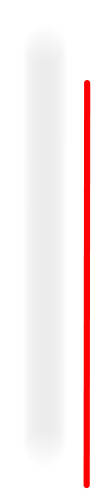
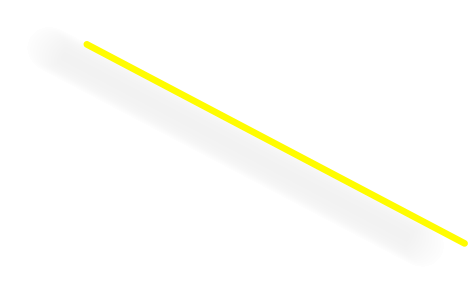
Epilog
UNENDLICH
ichtzahl
Unendlich,
sie
bleibt
für
uns
im
Sein
ans
Endliche
gebunden,
will
mehr
sagen
als
möglich
ist,
will
zu
viel
erdenken,
will
zu
viel
empfinden,
will
überschreiten
und
scheitert.
Deshalb
zerschlagen
wir
das
Gerüst,
nein,
auch
das
ist
zu
wenig,
überlassen
wir
das
Unendliche
dem
maßlosen
Maß,
überlassen
wir
morgen
und
gestern,
das
Sein
und
das
Nichts,
dem
im
Kommenden
immer
schon
Dagewesenen.
Im
Dasein
aber
ist
für
uns
immer
wieder
ein
Heute,
ein
neuer
Anfang
möglich,
ein
Anfang,
der
die
Gestalt
im
Ende
mit
zu
prägen
vermag.
Deshalb
verliere
nicht
den
Mut
im
Suchen
immer
neuen
Gestalten,
denn
die
Frage
des
Anfangs
-„Warum
ist
Etwas
und
nicht
vielmehr
Nichts?“-,
bleibt
zwar
auch
am
Ende
unseres
Fragen
ein
Geheimnis,
aber
zwischen
der
Eins
und
der
Zwölf
wurde
uns
geschenkt,
das
Geheimnis
um
ein
Winziges
zu
öffnen,
zu
öffnen
nicht
als
gewusste
Wirklichkeit,
aber
doch
als
erahnte,
erhoffte
Möglichkeit.
So
sind
wir,
und
alles,
sowohl
vom
Anfang
als
auch
vom
Ende
bedingt.
So
sind
wir gehalten in der Ewigkeit.
Im
Durchlässigwerden
zum
Geheimnis
hin
und
von
ihm
her,
in
seinem
Erspüren,
Erleben
und
Erkennen
in
allem
Sein,
wird
alles
Wirkliche
wirklicher,
denn
das
Unsagbare
wirkt,
wird
alles
Werden,
durch
das
Werden
in
neuem
Werden
erfüllt,
wird
das
Geheimnis
auch zu mir hin geöffnet.
Ich
staune
über
das
Wunder
des
Seins,
das
sich
mir
öffnet,
um
von
mir
angenommen
zu
werden.
Ich
lass
es
an
mir
geschehen,
lass
es
mich
sehen
und
hören,
mich
fühlen
und
denken.
Ich
bewege
das
Sein
durch
die
Wandlung
meiner
selbst.
Was
ist
wird
dann
auch
in
mir
Ganz.
Der
Kreis
beginnt
sich
zu
schließen,
die
Grundstruktur
ist
einmal
durchlaufen.
Ich
kehre
zum
Anfang,
zum
Alpha
zurück
und
beginne
meine
Symphonien
aufs
Neue
zu
komponieren,
mein
Suchen
des Ganzen im Dasein.
Ich
nutze
die
Struktur
der
144
Motive
in
den
12
Seinsebenen,
nehme
sie
immer
wieder
auf,
durchdringe
sie
horizontal,
vertikal
und
in
allen
anderen
Richtungen,
so
dass
sich
mir
das
Geheimnis
weiter
entfalten,
erweitern
und
zum
Ganzen,
zum
großen
Kristall,
öffnen
kann.
N
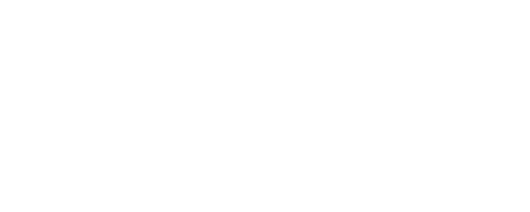
GENESIS – atomica primoprimaria
Vor Milliarden Jahren, als es mangels Sonne und Erde noch keine Jahre gab,
zur Zeit, als noch keine Zeit war, da geschah es eines Tages, als es weder
Tag noch Nacht gab, da habe es plötzlich einen Knall gegeben - den
"Urknall"
Wenn nun das Nichts nicht knallen kann, muß das Knallende wohl ein Es,
ein irgendwie Etwas, ein Seiendes, auf griechisch ein ON gewesen sein, das
auf einmal, wenn nicht schon von uran da war: das UR-ON
Im Anfang war das Ur-on, und das All war im Ur-On, und aus dem Ur-On ist
alles geworden
Und da waren, ob auf einmal, ob von uran, die "kleinsten Teilchen",
Und die Teilchen "liebten" einanderund sehnten sich nach Unteilbarem,und
sie schlossen sich innig zusammenund machten einen "Kern", und der Kern
hüllte sich in Mäntel (Neutron, Elektron).
Und so geschah es, daß das ATOMON war.
Viele Atomen entstanden:H, O, Na, C, Cl, N, S
Und auch die Atome "liebten" einanderund koppelten sich eifrig:
O nahm 2H an, und da ward das Wasser, Na nahm Cl, und ward das Salz:
Die Moleküle entstanden, Milliarden Moleküle.
Auch die Moleküle "liebten" einanderund schlossen sich zu seltsamen
Gesellschaften zusammen.
Und als sich ein paar Dutzende rlesener Molekülgesellschaften vereinigt
hatten, entsprang ihnen plötzlich - das LEBEN
Leben in Millionen Gestalten . . . . . . .und in allen wie von uran waltend - die
LIEBE
Was ist es - dieses Zusammenziehende, dieses Gestalten Erfindende und
Erschaffende?
Und was ist all der Sinn?
Ob nicht hinterm Thron des Kobolds, dem Menschenhirngespinst, das
verborgene Antlitz des Ursprungs lächeltund murmelt - den SINN?
Fridolin Stier16.11.1971
Teilhard de Chardin (1881-1955)
Weiteres zu Teilhard de Chardin auf: http://www.theodor-
frey.de/teilhardverzeichnis.htm
ist ein Visionär der Einheit, der Einheit des Universums von
seinem Anfang an bis zu seinem Ende, der Einheit des Einzelnen mit dem Ganzen, der
Einheit von Materie und Geist, der Einheit von Wissenschaft und Glauben, der Einheit des
immanenten Weltgeschehens mit dem transzendenten Gott. Die Einheit ist aber immer ein
evolutiver Prozess, ist Dynamik und Aufgabe.
Wenn mit dem Menschen Geist, Selbstbewusstsein, reflektierendes Denken, Freiheit
auftreten konnten, dann müssen - so Teilhard- diese Phänomene dem
Evolutionsgeschehen von Anfang an, wenn auch in noch so rudimentärer Form,
inngewohnt haben. In den Beziehungen und Bewegungen der Elemente entstanden und
entstehen weiterhin immer komplexere Gestalten bis hin zum Menschen (und darüber
hinaus?). „Im Bereich unserer Beobachtung repräsentiert der reflektierende Mensch den
erhabensten elementaren Zielpunkt dieser Bewegung der Anordnung“.
Teilhard de Chardin,
Die menschliche Energie, S. 338
Karl Rahner (1904-1984) bezieht sich in seinem Essay „Christologie innerhalb einer
evolutiven Weltanschauung“ auf Teilhard de Chardin. Auch er spricht der Materie eine
„aktive Selbsttranszendenz“ zu aus der „Kraft der absoluten Seinsfülle“, d.h. Gottes, die als
„Wesensselbsttranszendenz“ die Entwicklung über die Stufen „Materie, Leben,
Bewusstsein, Geist“ einschließe.